Reiseroute 2014
Yangon – Bagan (Ausflug nach Mt. Popa) – Sagaing (Stop unterwegs) – Mandalay (Ausflug nach Pyin U Lwin) – U Bein-Brücke (Stop unterwegs) – Kalaw (Wanderung durch die Dörfer der Umgebung) – Pindaya (Stop unterwegs) – Nyaungshwe (Inle-See, Ausflug nach Indein) – Yangon – Kawthoung – Myeik-Archipel (u.a. Insel 115, Bo Cho, Lampi Kyun, Swinton, Macleod) – Yangon
Ein Land im Wandel
„Wo fährst du denn hin?“, werde ich vor meiner Abreise gefragt. Diesmal stellt mich das vor eine Herausforderung: Sage ich nun „Birma“, „Burma“ oder „Myanmar“? (Und sind die Einwohner eigentlich Birmanen, Burmesen, Myanmarer, Myanmanen, Myanmarier, Myanmaren, Myanmaresen…?) „Burma“ ist der alte englische Name aus der Kolonialzeit, „Birma“ die deutsche Version und von den Militärs wurde das Fleckchen Erde zwischen Indien, Bangladesch, China, Laos und Thailand 1989 in „Myanmar“ umgetauft (ebenso wie viele Orte, was für Verwirrung sorgt). Beide Begriffe leiten sich von „Bamar“ ab, der größten der vielen Bevölkerungsgruppen.
 Nur Bares ist Wahres. Kreditkarten werden nirgendwo akzeptiert. FALSCH! Das Land verändert sich so schnell, dass Anfang 2014 die Angaben in 2013 erschienenen Reiseführern schon nicht mehr stimmen. Inzwischen steht selbst mitten in Yangons Shwedagon Pagode ein Geldautomat, der die Landeswährung Kyat ausspuckt. Lediglich auf dem Land sind makellose Dollar-Noten (seltsamerweise am liebsten 100er, für die gibt es einen besseren Kurs als für kleine Scheine) für den Umtausch nach wie unverzichtbar. Unerwartet habe ich an vielen Orten Internet-Zugang via W-LAN, komme problemlos an meine E-Mails. Nicht die einzige Überraschung: Bis vor kurzem durfte man weder Handys noch Presseprodukte nach Myanmar einführen. Jetzt wundert sich die Reisegruppe über einen Straßenstand mit Massen von Zeitungen und Zeitschriften, die Namen wie „Democracy“ tragen. „Die Pressezensur wurde abgeschafft“, erklärt unser Guide Louis, „60 Prozent des Inhalts bestehen aus Politik. Die Leute interessieren sich brennend dafür“. 2015 stehen (hoffentlich freie) Wahlen an. Louis kann jetzt offen sagen, dass er die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi unterstützt und uns ihr Haus zeigen. Früher undenkbar. Seit die Militärs 2011 nach rund 50 Jahren Diktatur einen zivilen Präsidenten als Staatsoberhaupt einsetzten, befindet sich das Land im Aufbruch. Überall wird gebaut, gestrichen (Bordsteine weißrot) und ordentlich gepflanzt. Auch die ursprünglich für den Abriss vorgesehenen Kolonialgebäude im Zentrum der ehemaligen Hauptstadt Yangon sollen erhalten werden.
Nur Bares ist Wahres. Kreditkarten werden nirgendwo akzeptiert. FALSCH! Das Land verändert sich so schnell, dass Anfang 2014 die Angaben in 2013 erschienenen Reiseführern schon nicht mehr stimmen. Inzwischen steht selbst mitten in Yangons Shwedagon Pagode ein Geldautomat, der die Landeswährung Kyat ausspuckt. Lediglich auf dem Land sind makellose Dollar-Noten (seltsamerweise am liebsten 100er, für die gibt es einen besseren Kurs als für kleine Scheine) für den Umtausch nach wie unverzichtbar. Unerwartet habe ich an vielen Orten Internet-Zugang via W-LAN, komme problemlos an meine E-Mails. Nicht die einzige Überraschung: Bis vor kurzem durfte man weder Handys noch Presseprodukte nach Myanmar einführen. Jetzt wundert sich die Reisegruppe über einen Straßenstand mit Massen von Zeitungen und Zeitschriften, die Namen wie „Democracy“ tragen. „Die Pressezensur wurde abgeschafft“, erklärt unser Guide Louis, „60 Prozent des Inhalts bestehen aus Politik. Die Leute interessieren sich brennend dafür“. 2015 stehen (hoffentlich freie) Wahlen an. Louis kann jetzt offen sagen, dass er die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi unterstützt und uns ihr Haus zeigen. Früher undenkbar. Seit die Militärs 2011 nach rund 50 Jahren Diktatur einen zivilen Präsidenten als Staatsoberhaupt einsetzten, befindet sich das Land im Aufbruch. Überall wird gebaut, gestrichen (Bordsteine weißrot) und ordentlich gepflanzt. Auch die ursprünglich für den Abriss vorgesehenen Kolonialgebäude im Zentrum der ehemaligen Hauptstadt Yangon sollen erhalten werden.
 Immer mehr Touristen besuchen Myanmar. An abgelegeneren Orten sind Fremde allerdings noch eine Attraktion. Zweimal sprechen mich an einem Wasserfall bei Pyin U Lwin Einheimische an, die sich mit mir fotografieren lassen wollen. Darunter ist auch ein junger Mönch mit seiner kompletten Familie, inkl. Oma. Unterwegs halten wir einmal in einem Dorf, in dem gerade ein Pagodenfestival stattfindet. Leider ist das Ochsenkarren-Rennen schon vorbei. Auch der Gesangswettbewerb mit traditionellen birmanischen Liedern neigt sich dem Ende zu. Während der letzte Teilnehmer singt, dreht sich das Publikum plötzlich um und blickt uns an. Eine ältere Frau nähert sich und befühlt die schneeweiße Haut einer englischen Mitreisenden. In der Stadt Kawthoung im äußersten Süden errege ich ebenfalls weit mehr Aufmerksamkeit, als mir lieb ist. Beim Bummel durch die Straßen folgen mir alle Augen. Ein kleiner Junge kommt sogar aus einem Haus angelaufen und überreicht mir feierlich eine Mango. „She su be (danke)!“ Damit habe ich ein Drittel meines birmanischen Wortschatzes angebracht. (Die Begrüßung „Mingalaba“ und die Abschiedsflokel „Tata“ sind der Rest). „Take care of tourists“, mahnt ein Schild die Einheimischen. Etwas doppeldeutig. Wenn nicht jeder, der mir entgegenkommt, so freundlich grüßen würde, wäre es mir unheimlich… Auf einem Felsen am Hafen befindet sich ein hübscher Park mit einer martialischen Statue von einem früheren König, der gerne mal im nahen Thailand eingefallen ist. Ich suche mir ein schattiges Plätzchen unter einem kieferartigen Baum. Auf einmal fühle ich, dass ich beobachtet werde. Vier Jungs sehen mich mit unverhohlener Neugier an. Ich denke: „Hey, ich bin die Touristin. Es ist mein Job, Leute anzustarren.“ Wieder bringe ich meinen Wortschatz an.
Immer mehr Touristen besuchen Myanmar. An abgelegeneren Orten sind Fremde allerdings noch eine Attraktion. Zweimal sprechen mich an einem Wasserfall bei Pyin U Lwin Einheimische an, die sich mit mir fotografieren lassen wollen. Darunter ist auch ein junger Mönch mit seiner kompletten Familie, inkl. Oma. Unterwegs halten wir einmal in einem Dorf, in dem gerade ein Pagodenfestival stattfindet. Leider ist das Ochsenkarren-Rennen schon vorbei. Auch der Gesangswettbewerb mit traditionellen birmanischen Liedern neigt sich dem Ende zu. Während der letzte Teilnehmer singt, dreht sich das Publikum plötzlich um und blickt uns an. Eine ältere Frau nähert sich und befühlt die schneeweiße Haut einer englischen Mitreisenden. In der Stadt Kawthoung im äußersten Süden errege ich ebenfalls weit mehr Aufmerksamkeit, als mir lieb ist. Beim Bummel durch die Straßen folgen mir alle Augen. Ein kleiner Junge kommt sogar aus einem Haus angelaufen und überreicht mir feierlich eine Mango. „She su be (danke)!“ Damit habe ich ein Drittel meines birmanischen Wortschatzes angebracht. (Die Begrüßung „Mingalaba“ und die Abschiedsflokel „Tata“ sind der Rest). „Take care of tourists“, mahnt ein Schild die Einheimischen. Etwas doppeldeutig. Wenn nicht jeder, der mir entgegenkommt, so freundlich grüßen würde, wäre es mir unheimlich… Auf einem Felsen am Hafen befindet sich ein hübscher Park mit einer martialischen Statue von einem früheren König, der gerne mal im nahen Thailand eingefallen ist. Ich suche mir ein schattiges Plätzchen unter einem kieferartigen Baum. Auf einmal fühle ich, dass ich beobachtet werde. Vier Jungs sehen mich mit unverhohlener Neugier an. Ich denke: „Hey, ich bin die Touristin. Es ist mein Job, Leute anzustarren.“ Wieder bringe ich meinen Wortschatz an.
Seitenanfang
Von wegen
„Friede, Freude, Eierkuchen“!
Fast 90 Prozent der Einwohner Myanmars sind Buddhisten, einige der größten buddhistischen Heiligtümer befinden sich im Land. Darunter ist die Shwedagon Pagode in Yangon. Sie besteht aus 60 Tonnen Gold und ist damit der größte Brocken der Welt. Dementsprechend glänzt sie. Bundespräsident Gauck ist auch gerade da. Ulkig, in Deutschland habe ich ihn noch nie getroffen. Viele der Buddha-Figuren in den Tempeln sind echt erleuchtet – mit bunt blinkenden Heiligenscheinen. Rund um die Pagode befinden sich einzelne Altäre für die acht (!) Wochentage (Mittwoch wird in Vormittag und Nachmittag unterteilt), die jeweils Tieren zugeordnet sind. Ich bin an einem Dienstag geboren und damit Löwe. In der Pagode sollen sich acht Haare Buddhas befinden. Des vierten der bisherigen Buddhas, man wartet gerade auf Nummer fünf. Wenn er erscheint, ist Armageddon: Die Welt, wie wir sie kennen, geht unter. Oder so. Es ist kompliziert. Unser Guide erzählt noch von 28 anderen Buddhas. Sind es also insgesamt 32? Nein, irgendwie nicht. Es ist sehr kompliziert. Der Buddhismus wird im Westen gerne als emanzipiert, tolerant und friedfertig idealisiert. Die Realität relativiert diesen Eindruck ein wenig.
 Emanzipiert? Die Terrasse der Shwedagon Pagode dürfen Frauen nicht betreten, andere Heiligtümer wie den Goldenen Fels bei Bago und Mönche nicht berühren. Viele der inbrünstig Betenden sind weiblich: Sie wollen nicht etwa Schönheit oder Reichtum, sondern im nächsten Leben als Mann wiedergeboren werden. Frauen können nämlich nicht erleuchtet werden und das Nirwana erreichen, müssen also in jedem Fall noch mindestens eine Runde auf der Erde drehen. Tolerant? In Mandalay sehen wir einmal eine Prozession von Indern vorbeikommen, die Buddha und eine Hindu-Gottheit tragen. Moslems dürften auf der Straße nicht so einen Krach machen, erklärt Louis. Im Rakhaing-Staat kommt es mit der moslemischen Minderheit der Rohingya sogar zu brügerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Friedfertig? In Bagan wurden vom 11. bis 13. Jahrhundert tausende von Tempeln und Pagoden errichtet, von denen viele noch erhalten sind. In der Regel wurden sie von Reichen und Mächtigen gestiftet, die etwas kompensieren wollten. Narathu beispielsweise hat im 12. Jahrhundert erst den Vater, dann den älteren Bruder umgebracht, um König zu werden. Als ihn später seine Frau genervt hat, auch sie. Um sein Karma-Konto auszugleichen, ließ er in Bagan aus Ziegelsteinen den Dhammayangyi Tempel bauen. Damit die Arbeiter anschließend nie wieder so etwas Perfektes schaffen konnten, wurden sie lebendig eingemauert. Dort sitzen sie immer noch. Innen wirkt das Ganze entsprechend gruselig, überall hängen Fledermäuse an der Decke. Auch heute noch werden manchmal Menschen geopfert, erfahren wir von Louis. Vor fünf Jahren verloren fünf unverheiratete Männer mit glücksverheißenden Namen ihr Leben, damit ein Brückenprojekt unter einem guten Stern steht. (Aber das fällt mehr in den Bereich „Aberglaube“, s.u.).
Emanzipiert? Die Terrasse der Shwedagon Pagode dürfen Frauen nicht betreten, andere Heiligtümer wie den Goldenen Fels bei Bago und Mönche nicht berühren. Viele der inbrünstig Betenden sind weiblich: Sie wollen nicht etwa Schönheit oder Reichtum, sondern im nächsten Leben als Mann wiedergeboren werden. Frauen können nämlich nicht erleuchtet werden und das Nirwana erreichen, müssen also in jedem Fall noch mindestens eine Runde auf der Erde drehen. Tolerant? In Mandalay sehen wir einmal eine Prozession von Indern vorbeikommen, die Buddha und eine Hindu-Gottheit tragen. Moslems dürften auf der Straße nicht so einen Krach machen, erklärt Louis. Im Rakhaing-Staat kommt es mit der moslemischen Minderheit der Rohingya sogar zu brügerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Friedfertig? In Bagan wurden vom 11. bis 13. Jahrhundert tausende von Tempeln und Pagoden errichtet, von denen viele noch erhalten sind. In der Regel wurden sie von Reichen und Mächtigen gestiftet, die etwas kompensieren wollten. Narathu beispielsweise hat im 12. Jahrhundert erst den Vater, dann den älteren Bruder umgebracht, um König zu werden. Als ihn später seine Frau genervt hat, auch sie. Um sein Karma-Konto auszugleichen, ließ er in Bagan aus Ziegelsteinen den Dhammayangyi Tempel bauen. Damit die Arbeiter anschließend nie wieder so etwas Perfektes schaffen konnten, wurden sie lebendig eingemauert. Dort sitzen sie immer noch. Innen wirkt das Ganze entsprechend gruselig, überall hängen Fledermäuse an der Decke. Auch heute noch werden manchmal Menschen geopfert, erfahren wir von Louis. Vor fünf Jahren verloren fünf unverheiratete Männer mit glücksverheißenden Namen ihr Leben, damit ein Brückenprojekt unter einem guten Stern steht. (Aber das fällt mehr in den Bereich „Aberglaube“, s.u.).
In den sehr alten Tempeln Bagans sind auch indische Gottheiten wie Brahma und Vishnu zu sehen. Allerdings wurden sie von den Buddhisten zu Geistern (Nats) degradiert. Umgekehrt betrachten die Hindus Buddha ähnlich wie die Moslems Jesus nur als eine Art Propheten. Manche der Monumente kann und darf man besteigen. Die Stufen sind sehr steil. Der Himmel muss halt erarbeitet werden.
 Beim Besuch von Tempeln, Pagoden, Heiligtümern und Klöstern erscheint für Außenstehende manches widersprüchlich oder skurril: Schuhe müssen grundsätzlich draußenbleiben. Vor dem Betreten muss man sie ausziehen und stehenlassen. Auch die Socken. (Was ist eigentlich, wenn einer einen Gips trägt?) Da kennen die Buddhisten keine Gnade, selbst wenn es schneit. Als wir die Höhlen von Pindaya mit ihren 8000 Buddhas besichtigen (nach der Penishöhle in Thailand die zweitschrägste Grotte, die ich je gesehen habe), ist es ziemlich frisch. Kalte Füße! Komischerweise befinden sich beispielsweise in der Two Snake Pagode auf dem Mandalay Hill überall Stände, die Schuhe verkaufen. Wieso dürfen die hier rein? In Indein nahe dem Inle-See, wo sich zahllose Stupas in allen Stadien der Renovierung befinden, steht sogar ein Motorrad direkt im Eingang des Tempels. Müsste das nicht wenigstens die Reifen ablegen?
Beim Besuch von Tempeln, Pagoden, Heiligtümern und Klöstern erscheint für Außenstehende manches widersprüchlich oder skurril: Schuhe müssen grundsätzlich draußenbleiben. Vor dem Betreten muss man sie ausziehen und stehenlassen. Auch die Socken. (Was ist eigentlich, wenn einer einen Gips trägt?) Da kennen die Buddhisten keine Gnade, selbst wenn es schneit. Als wir die Höhlen von Pindaya mit ihren 8000 Buddhas besichtigen (nach der Penishöhle in Thailand die zweitschrägste Grotte, die ich je gesehen habe), ist es ziemlich frisch. Kalte Füße! Komischerweise befinden sich beispielsweise in der Two Snake Pagode auf dem Mandalay Hill überall Stände, die Schuhe verkaufen. Wieso dürfen die hier rein? In Indein nahe dem Inle-See, wo sich zahllose Stupas in allen Stadien der Renovierung befinden, steht sogar ein Motorrad direkt im Eingang des Tempels. Müsste das nicht wenigstens die Reifen ablegen?
Jeder Buddhist sollte hin und wieder Zeit im Kloster verbringen. Insgesamt gibt es rund 500.000 Mönche in Myanmar. Schon Kinder leben mindestens fünf Tage lang als Mönch oder Nonne. Alle werden kahlgeschoren. Jungs und Mädchen sind oft nur an Farbe des Gewands zu unterscheiden. Einmal sehe ich einen Mini-Mönch mit einer Plastikpistole spielen. Ein seltsamer Anblick… In Sagaing besichtigen wir die Sun U Ponnya Shin-Pagode, die von der Terrasse einen herrlichen Blick bietet. Dort telefoniert ein Mönch gerade mit dem Handy. Beim Besuch auf dem Mandalay Hill knipsen sich junge Mönche fleißig gegenseitig. Buddha hat zwar gesagt, Luxus sei schlecht. Handys, Tablets und Fotoapparate hat er hingegen vor ca. 2500 Jahren nicht erwähnt. Ähnlich: Mönche dürfen nicht trinken, doch das Rauchen hat Buddha nicht ausdrücklich verboten. Íst also erlaubt. Irgendwie. Während sich Mönche morgens barfuß ihr Essen erbetteln, sieht man sie sonst auch auf Motorrädern vorbeiknattern.
Eine Kuriosität existiert leider nicht mehr: Im Inle-See gibt es das Kloster Nga Phe Chaung Kyaung, in dem Mönche die örtlichen Katzen durch Reifen springen ließen. Das haben sie aufgegeben, weil sich die Touristen dafür weit mehr interessierten, als für die historischen Altäre.
Seitenanfang
Links fahren bringt Unglück
 Neben der Religion spielt der Glaube an Geister eine wichtige Rolle. Der Übergang ist fließend. Die sogenannten Nats wurden genormt, auf 37 reduziert und in den Buddhismus integriert. Sie lassen sich wohl ganz gut mit den katholischen Heiligen vergleichen. In der Regel sind es reale Personen, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Die meisten sind Frauen (sind eher geeignet als böse Geister herumzuspuken). Ihr Zentrum ist Mt. Popa, bzw. die Felsnadel, die davor in der Ebene aufragt. Eine überdachte Treppe führt zum Tempel an der Spitze. Zwischen Buddhas in Schneekugeln toben wilde Affen herum. Auch in der Two Snake Pagode wird die Vermischung zwischen Geisterglauben und Buddhismus deutlich: Eine Figur zeigt eine Ogerin, die ihre abgeschnittenen Brüste in der Hand hält. Sie hat sie Buddha geopfert, um als König wiedergeboren zu werden. Das nutzte sie/er dann weidlich aus. Die Majestät hatte 500 offizielle und 500 inoffizielle Frauen und ließ in Mandalay einen riesigen Palast (jeweils 1 km im Quadrat) anlegen.
Neben der Religion spielt der Glaube an Geister eine wichtige Rolle. Der Übergang ist fließend. Die sogenannten Nats wurden genormt, auf 37 reduziert und in den Buddhismus integriert. Sie lassen sich wohl ganz gut mit den katholischen Heiligen vergleichen. In der Regel sind es reale Personen, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Die meisten sind Frauen (sind eher geeignet als böse Geister herumzuspuken). Ihr Zentrum ist Mt. Popa, bzw. die Felsnadel, die davor in der Ebene aufragt. Eine überdachte Treppe führt zum Tempel an der Spitze. Zwischen Buddhas in Schneekugeln toben wilde Affen herum. Auch in der Two Snake Pagode wird die Vermischung zwischen Geisterglauben und Buddhismus deutlich: Eine Figur zeigt eine Ogerin, die ihre abgeschnittenen Brüste in der Hand hält. Sie hat sie Buddha geopfert, um als König wiedergeboren zu werden. Das nutzte sie/er dann weidlich aus. Die Majestät hatte 500 offizielle und 500 inoffizielle Frauen und ließ in Mandalay einen riesigen Palast (jeweils 1 km im Quadrat) anlegen.
Die Macht, die Astrologie und Aberglaube in Myanmar ausüben, ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Man darf z.B. einen Busfahrer nicht fragen, wann man da ist (bringt Unglück, warum auch immer). Im Gegensatz zu Männern dürfen Frauen nicht auf dem Dach eines Pickups sitzen (bringt Unglück, denn dann wären sie ja über ihnen). Den Shan-Staat darf man nicht mit neun Personen betreten (bringt Unglück, weil es hier neun Geister gibt). Notfalls muss man noch einen Stein als zehnte Person mitnehmen. Ex-Dikator Ne Win war besonders abergläubisch: Auf Rat seiner Astrologen hat er urplötzlich den Verkehr von links auf rechts umgestellt. Noch heute haben viele Autos das Steuer auf der nun falschen Seite. Eines anderen Tages hat er einige Banknoten für ungültig erklärt und stattdessen 45er und 90er eingeführt. Angeblich sollte die 9 seine Glückszahl sein. Die 8 war es definitiv nicht: Daraufhin wurde er am 8.8.88 gestürzt.
Seitenanfang
Mehr als Pagoden und Stupas
 „Overpagodaed“ oder „templed out“ heißt es auf Englisch, wenn Touristen genug vom Heiligen Bimbam haben. Tatsächlich gibt es in Myanmar noch weit mehr zu entdecken. Start-, End- und Mittelpunkt meiner Rundreise ist die ehemalige Hauptstadt Yangon. Zunächst schieße ich allerdings 675 km übers Ziel hinaus und lande in Bangkok, weil der Flughafen wegen schlechter Sicht geschlossen ist. Auftanken, warten, bis sich der Nebel verzogen hat. Endlich kann ich die City bei einem Spaziergang erkunden. Bis vor kurzem waren Autos unerschwinglich, jetzt wimmelt es vor hupenden Wagen. Immerhin hat irgendein Diktator einst Motor- und Fahrräder aus der Stadt verbannt, weil er sich darüber geärgert hatte. Trotzdem ist das Überqueren einer Straße etwas für Schnelle und Unerschrockene. Man muss irgendwann einfach loslaufen, sonst kommt man nie auf die andere Seite. Hier sind die Leute schicksalsergeben (wenn ich überfahren werde, sollte es so sein). Zum Glück bringt Leute Umzunieten schlechtes Karma und wird möglichst vermieden. Von den Balkons der Appartmenthäuser hängen Seile. Es sind Aufzüge für Geschäfte: Ein Säckchen gebratener Reis als Frühstück fährt hoch, das Geld dafür runter. An Straßenständen werden kleingehackte Betelnüsse in Blätter verpackt. Es ist eine Art Kautabak. Das erklärt auch die roten Flecken auf den Bürgersteigen. Kein Blut, sondern die Rückstände vom Ausspucken des Saftes. Die uralten Telefone, die überall bereitstehen, werden wohl bald verschwinden. Handys sind jetzt auch erlaubt, bezahlbar und nicht mehr aufzuhalten. Noch vor kurzem kostete eine SIM-Karte noch 3500 Dollar, heute zwei. Das Trinkwasser, das ebenfalls überall kostenlos angeboten wird, hingegen wird bleiben: Es gilt als gutes Werk, das Punkte auf dem Karma-Konto bringt.
„Overpagodaed“ oder „templed out“ heißt es auf Englisch, wenn Touristen genug vom Heiligen Bimbam haben. Tatsächlich gibt es in Myanmar noch weit mehr zu entdecken. Start-, End- und Mittelpunkt meiner Rundreise ist die ehemalige Hauptstadt Yangon. Zunächst schieße ich allerdings 675 km übers Ziel hinaus und lande in Bangkok, weil der Flughafen wegen schlechter Sicht geschlossen ist. Auftanken, warten, bis sich der Nebel verzogen hat. Endlich kann ich die City bei einem Spaziergang erkunden. Bis vor kurzem waren Autos unerschwinglich, jetzt wimmelt es vor hupenden Wagen. Immerhin hat irgendein Diktator einst Motor- und Fahrräder aus der Stadt verbannt, weil er sich darüber geärgert hatte. Trotzdem ist das Überqueren einer Straße etwas für Schnelle und Unerschrockene. Man muss irgendwann einfach loslaufen, sonst kommt man nie auf die andere Seite. Hier sind die Leute schicksalsergeben (wenn ich überfahren werde, sollte es so sein). Zum Glück bringt Leute Umzunieten schlechtes Karma und wird möglichst vermieden. Von den Balkons der Appartmenthäuser hängen Seile. Es sind Aufzüge für Geschäfte: Ein Säckchen gebratener Reis als Frühstück fährt hoch, das Geld dafür runter. An Straßenständen werden kleingehackte Betelnüsse in Blätter verpackt. Es ist eine Art Kautabak. Das erklärt auch die roten Flecken auf den Bürgersteigen. Kein Blut, sondern die Rückstände vom Ausspucken des Saftes. Die uralten Telefone, die überall bereitstehen, werden wohl bald verschwinden. Handys sind jetzt auch erlaubt, bezahlbar und nicht mehr aufzuhalten. Noch vor kurzem kostete eine SIM-Karte noch 3500 Dollar, heute zwei. Das Trinkwasser, das ebenfalls überall kostenlos angeboten wird, hingegen wird bleiben: Es gilt als gutes Werk, das Punkte auf dem Karma-Konto bringt.
An einem Nachmittag besuche ich den Zoo. 1906 gegründet, befindet er sich fast noch im Originalzustand. Einige Tiere (z.B. die weißen Tiger und die Malaienbären) bieten in ihren viel zu kleinen Käfigen einen traurigen Anblick, während andere schönere Gehege haben. Ungewohnt: Fast alle Tiere dürfen gefüttert werden. Sogar die Nilpferde kommen angwatschelt und reißen erwartungsvoll die Klappe auf.
Den letzten Abend mit der Gruppe verbringen wir im China-Restaurant „Junior Duck“ am Fluss. Interessante Speisekarte: Fischköpfe und Hühnerfüße gehören noch zu den konventionelleren Gerichten. Das bestellte Hühnchen in den Nudeln ist bestenfalls durch den Wolf gedrehtes Schweinefleisch. Am nächsten Tag will ich einen Pool zum Schwimmen. Nicht einfach, ein Hotel zu finden, das überhaupt einen hat, und zudem Nicht-Gäste zulässt. Schließlich lande ich erneut im Park Royal, das stolze 20 Dollar für ein ziemlich übersichtliches Becken verlangt. Auch die Cocktailpreise (7 Dollar) sind gesalzen.
Von Yangon fliegen wir in die ehemalige Königsstadt Bagan im Zentrum des Landes. Dort genieße ich eine traditionelle Massage direkt im Hotelzimmer, eine ganze Stunde kostet keine fünf Euro. Bei einer Fahrradtour von Tempel zu Tempel sehen wir auch, wie eine beliebte Süßigkeit hergestellt wrid: Palmen werden „gemolken“, der Saft wird gekocht. Wenn er abgekühlt ist, wird die Masse zu bonbonartigen Bällchen geformt. Außerdem wird das Ganze fermentiert zu einer Art Bier und destilliert zu einer Art Grappa.
 Auf dem Ayeyarwady fahren wir mit einem Holzboot namens Shwe Naingngan (goldenes Land), das nur ca. 1,50 Meter Tiefgang hat, von Bagan nach Mandalay. In der Trockenzeit ist der Fluss voller Sandbänke, immer wieder stochern die Maate mit langen Bambusstangen, um die Wassertiefe zu testen. Es gibt weder Fahrwassermarkierungen noch ein Echolot. Viele Frachter mit Teakstämmen sind Richtung Yangon unterwegs. Das oberste Stück wird mit Bambusflössen zurückgelegt, dann wird auf Frachter umgeladen. Gemächlich fahren wir ihnen entgegen den Fluss hinauf, trinken frischen Ingwertee und genießen die leichte Brise. Zwischendurch halten wir im Dorf Yandabo, das aufs Töpfern spezialisiert ist, und probieren eine Spezialität der Gegend: klebrigen Reis.
Auf dem Ayeyarwady fahren wir mit einem Holzboot namens Shwe Naingngan (goldenes Land), das nur ca. 1,50 Meter Tiefgang hat, von Bagan nach Mandalay. In der Trockenzeit ist der Fluss voller Sandbänke, immer wieder stochern die Maate mit langen Bambusstangen, um die Wassertiefe zu testen. Es gibt weder Fahrwassermarkierungen noch ein Echolot. Viele Frachter mit Teakstämmen sind Richtung Yangon unterwegs. Das oberste Stück wird mit Bambusflössen zurückgelegt, dann wird auf Frachter umgeladen. Gemächlich fahren wir ihnen entgegen den Fluss hinauf, trinken frischen Ingwertee und genießen die leichte Brise. Zwischendurch halten wir im Dorf Yandabo, das aufs Töpfern spezialisiert ist, und probieren eine Spezialität der Gegend: klebrigen Reis.
Abends erleben wir einen stimmungsvollen Sonnenuntergang über dem Fluss und schlafen unter Moskitonetzen an Deck, soweit es möglich ist. Laute Musik schallt vom Ufer herüber. Es klingt, als würde jeder wild auf sein Instrument einhämmern, während eine Katze erwürgt wird, und geht die ganze Nacht. In einem Dorf, das man gar nicht sehen kann, ist gerade ein Festival. Gefeiert wird in Myanmar oft und ausgiebig, Gründe gibt es genug: Vollmond, Neumond, jeder der 37 Nats hat seinen Tag, Pagoden und Tempel ebenfalls, Initiation eines Mönchs oder einer Nonne… Morgens versöhnt uns ein herrlicher Sonnenaufgang über dem Fluss.
Von Mandalay machen wir einen Ausflug nach Pyin U Lwin, das den Engländern einst als Sommerfrische diente. Das Städtchen hat seinen Charme behalten. Noch heute fahren alte Pferdekutschen die Gäste umher. Wir besuchen den lebhaften Markt, einen Wasserfall und den wunderschönen botanischen Garten. Am nächsten Tag halten wir unterwegs in Amapurna. Es ist ebenfalls eine ehemalige Königsstadt. Von denen gibt es viele in Myanmar, da Könige, die etwas Schlimmes getan hatten, die Hauptstadt zwecks spiritueller Reinigung gerne verlegten. Wir laufen über die berühmte U Bein-Brücke, die komplett aus Teak besteht. Die Konstruktion ist leicht wackelig und hat kein Geländer.
 Weiter geht es aus der staubigen Zentralebene hoch in die Berge des Shan-Staates. Wir befinden uns jetzt im Goldenen Dreieck. Offiziell sind Drogen streng verboten, aber Regierungsmitglieder bauen sie selbst an. Bei langen Nachtfahrten dopen sich die Trucker gerne, indem sie Amphetamin rauchen, erklärt unser Tourguide Louis. Dann brettern sie mit altersschwachen Lkw über die gewundene, enge Straße. Wer die Droge in Pillenform kaufen will, gibt das mit einer simplen Handgeste zu verstehen: Zeige-, Mittel- und Ringfinger hoch, Daumen und kleiner Finger als Kreis, sodass die Kuppe des kleinen Fingers wie eine Pille übersteht. Myanmar ist mittlerweile vor Afghanistan der weltgrößte Drogenproduzent.
Weiter geht es aus der staubigen Zentralebene hoch in die Berge des Shan-Staates. Wir befinden uns jetzt im Goldenen Dreieck. Offiziell sind Drogen streng verboten, aber Regierungsmitglieder bauen sie selbst an. Bei langen Nachtfahrten dopen sich die Trucker gerne, indem sie Amphetamin rauchen, erklärt unser Tourguide Louis. Dann brettern sie mit altersschwachen Lkw über die gewundene, enge Straße. Wer die Droge in Pillenform kaufen will, gibt das mit einer simplen Handgeste zu verstehen: Zeige-, Mittel- und Ringfinger hoch, Daumen und kleiner Finger als Kreis, sodass die Kuppe des kleinen Fingers wie eine Pille übersteht. Myanmar ist mittlerweile vor Afghanistan der weltgrößte Drogenproduzent.
Von Kalaw aus wandern wir durch die umliegenden Berge. Die Gegend ist äußerst fruchtbar: Es wachsen tropische Früchte wie Ananas und Bananen, dazu Zitrusfrüchte, Weintrauben, riesige Kohlköpfe, Ingwer, Zitronengras und vieles mehr. Im Dorf Pein Ne Bin essen wir zu Mittag. Dort leben die Palaung. Man darf ihre traditionelle Tracht anprobieren. Sehr kleidsam. Allerdings ist die turbanähnliche Kopfbedeckung für die verheirateten Frauen noch hübscher als die für die Singles, die etwas an die Schwarzwälder Bollenhüte erinnert. Schließlich endet die Tour in Myin Ga. Unterwegs unterhält der örtliche Guide die Gruppe, indem er aus einem Grashalm ein mit den Armen wedelndes Männchen bastelt, die Schale einer Mandarine so abschält, dass es aussieht, als würde ein Frosch die Frucht tragen, und einer Sonnenblume eine Sonnenbrille aufsetzt.
 Bevor wir weiterfahren, bummeln wir über den großen Markt von Kalaw, der nur alle fünf Tage stattfindet. Von einem der Verkaufsstände bietet uns Louis einen Snack an. Es schmeckt nach Knoblauch und Chili und etwas säuerlich. Geröstete Ameisen! Im Shan-Staat essen sie auch Hunde (aber nur die Schwarzen). Unsere nächste Station ist Nyaungshwe. Von dort aus kreuzen wir mit einem Boot über den Inle-See. Er ist maximal vier Meter tief, am und im See stehen auf Pfählen 25 Dörfer mit 40.000 Einwohnern. In Nampan gehen wir über den Markt, der den See im Fünf-Tages-Rhythmus umkreist. Ferner besichtigen wir eine Weberei, die Stoffe aus Seide und Lotusfasern herstellt, eine Bootswerft, eine Werkstatt für Shan-Papier und eine Silberschmiede. Interessant sind auch die schwimmenden Gärten, in denen vor allem Tomaten angebaut werden. Weltweit einmalig ist die Rudertechnik der örtlichen Fischer: Sie paddeln mit einem Bein, damit sie beide Hände zum Arbeiten frei haben.
Bevor wir weiterfahren, bummeln wir über den großen Markt von Kalaw, der nur alle fünf Tage stattfindet. Von einem der Verkaufsstände bietet uns Louis einen Snack an. Es schmeckt nach Knoblauch und Chili und etwas säuerlich. Geröstete Ameisen! Im Shan-Staat essen sie auch Hunde (aber nur die Schwarzen). Unsere nächste Station ist Nyaungshwe. Von dort aus kreuzen wir mit einem Boot über den Inle-See. Er ist maximal vier Meter tief, am und im See stehen auf Pfählen 25 Dörfer mit 40.000 Einwohnern. In Nampan gehen wir über den Markt, der den See im Fünf-Tages-Rhythmus umkreist. Ferner besichtigen wir eine Weberei, die Stoffe aus Seide und Lotusfasern herstellt, eine Bootswerft, eine Werkstatt für Shan-Papier und eine Silberschmiede. Interessant sind auch die schwimmenden Gärten, in denen vor allem Tomaten angebaut werden. Weltweit einmalig ist die Rudertechnik der örtlichen Fischer: Sie paddeln mit einem Bein, damit sie beide Hände zum Arbeiten frei haben.
Bevor wir nach Yangon zurückfliegen, essen wir in der größten und ältesten Weinkellerei in Myanmar zu Abend. Insgesamt gibt es zwei. Wein wächst nur in der Gegend um den Inle-See. In der ultramodernen Anlage wird Sauvignon Blanc und Shyraz produziert, 150.000 Liter pro Jahr. Eichenfässer werden im Land hergestellt, aber Flaschen müssen importiert werden, weil es keine Fabriken dafür gibt. Besitzer ist ein ehemaliger Shan-Rebell, der sich allerdings Spezialisten aus Italien und Frankreich geholt hat. Dementsprechend ist der Wein richtig gut. Die andere Kellerei gehört einem Deutschen.
Seitenanfang
Tief im Süden
Von Yangon fliege ich in die Hafenstadt Kawthoung im äußersten Süden Myanmars an der Grenze zu Thailand. Auf dem Landweg dürfen Touristen die Strecke immer noch nicht zurücklegen. Die Propellermaschine macht zwei Zwischenlandungen und braucht so mehr als drei Stunden. Ich bin die einzige Nicht-Asiatin an Bord. In der ersten Reihe sitzt ein älterer Mönch, der offensichtlich ein wichtiger Würdenträger ist. Passagiere und Crew verneigen sich tief vor ihm. Als er in Myeik aussteigt, wird er von einer Pressemeute empfangen und mit einem golden glänzenden Schirm vom Rollfeld begleitet.
Im Gegensatz zu Yangon gibt es in Kawthoung (noch) kaum Autos. Dafür umso mehr Motorräder. Das Personal im Hotel ist sehr freundlich, spricht aber kaum Englisch. Einen Stadtplan haben sie nicht, aber W-LAN. Es ist extrem langsam, dennoch schaffe ich es Google Maps aufzurufen. So finde ich den Weg von etwas außerhalb des Zentrums zum Hafen und sehe einen Katamaran mit dem Logo des Reiseveranstalters in der Bucht liegen. Sonst sind lediglich ein zweiter Karamaran und ein Zweimaster zu sehen. Bevor ich am nächsten Morgen an Bord gehe, streife ich über den lebhaften Nachtmarkt.

Eine Woche lang segele ich durch den Myeik Archipel. Bis 1996 waren die unzähligen Inseln völlig von der Außenwelt isoliert. Abgesehen von einigen Tauchern, die meist auf ihren Schiffen bleiben, verirren sich nur wenige Ausländer dorthin. Dementsprechend leer sind die fantastischen Strände. Auf den wenigen bewohnten Inseln leben Moken. Einige der Seenomaden sind von der Regierung gezwungen worden, sesshaft zu werden. Viele jedoch suchen sich nur während der Regenzeit eine vorübergehende Bleibe und wohnen auf ihren Booten. Wie wir: Unser Schiff heißt „Simile“ und fährt unter deutscher Flagge. Kapitän Mike stammt aus Südafrika und versichert uns: „Nach diesen sechs Tagen werdet ihr nicht mehr dieselben sein. Ich werde Euch den besten Urlaub eures Lebens verschaffen.“ Um in meine Kajüte zu gelangen, lasse ich mich durch eine Luke fallen und taste mit dem Fuß nach einem Regalbrett, das als „Leiter“ dient. „Wie ist denn der reguläre Zugang?“, fragt Mitpassagier Roland. „Das ist der reguläre Zugang!“ Zwischen uns und dem Paradies steht nur noch die Einwanderungsbehörde. Der Beamte kommt an Bord, nimmt ungefragt ein Bier aus der Kühlbox, sammelt die Pässe und 140 Dollar pro Person ein und geht wieder. Dann warten wir erstmal zwei Stunden, bis der erlösende Anruf kommt. Wir dürfen losfahren. Die Pässe bleiben in Kawthoung. Das hat auch seine Vorteile: Zwei Wochen zuvor ist auf See ein Tauchboot in Brand geraten und explodiert. Passagiere und Crew konnten gerade noch ihr Leben retten, haben sonst aber alles verloren – bis auf die Pässe…
Die erste Fahrt machen wir mit dem Motor. Es weht zwar etwas Wind, aber leider von vorn. Im Dezember und Januar hat es kräftig geblasen, erzählt Mike. Im Moment ist eine ruhigere Phase, bevor die Regenzeit einsetzt. Dann ist Schluss mit Segeln in dem Gebiet: Taifune drohen. Überhaupt ist das Revier recht tückisch: Kräftige Strömungen und Korallenbänke sind nichts für Anfänger. Deshalb kann man auch nicht einfach ein Boot ohne Kapitän chartern. Die erste Nacht verbringen wir ankernd vor White Monkey Island. Am nächsten Mittag folgt der erste Schnorchelgang an einem nagelneuen Pier. Das dazugehörige Resort ist seit Jahren im Bau. Recht vielversprechend: u.a. entdecke ich Clownfische, Papageienfische, Kofferfische und lebende (!) Korallen die aussehen, als hätten sie Blüten (später erfahre ich; es sind Würmer), die sich bei Annäherung zurückziehen. Nach dem Schnorcheln geht Skipper Mike mit der Harpune ins Wasser, um das Abendessen aufzupeppen. Etwas enttäuscht kommt er mit zwei Groupern und einem Snapper zurück. Weiter gehts zur Nachbarinsel, die den banalen Namen 115 trägt. Die Seenomaden, die eine Woche zuvor in der Bucht gecampt haben, sind verschwunden. Dafür liegt einiges an Plastikmüll am Strand. Ganz so tradititionell ist ihre Lebensweise auch nicht mehr. Bei unserer Miniwanderung von einem Strand zum anderen findet unser birmanischer Guide Cho Cho den Rückweg selbst erst im zweiten Anlauf. Ein Relikt aus der Militärdiktatur: Jedes Schiff muss neben der Crew einen Guide des Tourismusministeriums MTT an Bord haben. Der ist mit 365 Dollar pro Woche das teuerste Crewmitglied, seufzt Mike. Und das Entbehrlichste, denn die meisten können kaum Englisch. Auch Cho Cho „antwortet“ auf Fragen mit einem freundlichen Lächeln und scheint den Urlaub selber zu genießen. Ist wohl ein Traumjob, den nur Jungs mit guten Regierungskontakten kriegen… Zum ersten Mal in meinem Leben gehe ich nachts schnorcheln. Es ist gar nicht so gruselig, wie gedacht. Im Schein meiner wasserdichten Taschenlampe tauchen ein Tintenfisch und ein großer Kofferfisch auf.
Am Tag darauf ist endlich genug Wind zum Segeln. Lässig pflügt Simile (15 Jahre alt, 8,5 Meter breit, 52 Fuß lang, weltweit ein Einzelstück und schon um Kap Horn gesegelt) durch die Wellen. Der grundsolide Katamaran schafft über 20 Knoten. Sein Eigner hat damit schon eine Regatta auf den Azoren gewonnen. Aber davon sind wir weit entfernt. Das Boot hat eine Pinne, die man mit zwei Fingern steuern kann, so gut hat Mike die Segel getrimmt. Plötzlich dreht er in den Wind: An der Angel hängt ein kleiner Thunfisch. Der wird gleich darauf in Teile verlegt und roh verzehrt – mariniert mit Zitronensaft, Tabasco und grünem Pfeffer. Wenn man ihn brät, wird er schnell trocken, meint Mike. Und frisch ist er ja.
 Wir ankern vor der Insel Bo Cho und besuchen mit dem Dinghi Ma Kyone Galet, das mit ca. 850 Einwohnern größte Dorf der Region. Dort leben vor allem Moken, aber auch Fischer vom Festland. Hunde mit Welpen begrüßen uns. Sofort kommen Kinder anfgelaufen und haben riesigen Spaß an unseren Fotokameras (mein großer Touchscreen ist der Bringer). Beim Besuch der örtlichen Pagode ziehen wir – wie es sich gehört – die Schuhe aus (ein Mönch vor Ort trägt allerdings welche, ebenso ein Funkgerät, und raucht). Als wir zurückkommen, hat ein Junge zum Vergnügen seiner Freunde meine Gummi-Ballerinas an. Praktisch alle im Dorf leben vom Fischfang. Schon die Jüngsten jagen mit Mini-Speeren die Krabben in den Tümpeln, die die Ebbe zurückgelassen hat. Für die Schulkinder ist heute ein besonderer Tag: Die Schiffseigner und die Stiftung des Reiseveranstalters haben einen Computer mit einem Übersetzungsprogramm birmanisch/englisch und einen Drucker gekauft. Beides wird feierlich dem Direktor überreicht. An der Wand hängt ein Schild: „Building a Modern-developed Nation through Education“. Erst seit kurzem ist der Schulbesuch in Myanmar kostenlos. Nach wie vor ist er keine Pflicht, deshalb sehen viele nicht ein, warum sie gehen sollten. Es ist klar: Myanmar wird sich auch in dieser entlegenen Ecke ändern. Die Tage, in denen nur einmal pro Woche eine Handvoll Touristen vorbeischaut, sind gezählt. Das hinterlässt gemischte Gefühle: Zwar hat die Öffnung des Landes der bisher schwer drangsalierten Bevölkerung sehr geholfen, Touristen bringen Geld in die arme Gegend. Aber ob die traditionelle Kultur den erwarteten Ansturm überlebt?
Wir ankern vor der Insel Bo Cho und besuchen mit dem Dinghi Ma Kyone Galet, das mit ca. 850 Einwohnern größte Dorf der Region. Dort leben vor allem Moken, aber auch Fischer vom Festland. Hunde mit Welpen begrüßen uns. Sofort kommen Kinder anfgelaufen und haben riesigen Spaß an unseren Fotokameras (mein großer Touchscreen ist der Bringer). Beim Besuch der örtlichen Pagode ziehen wir – wie es sich gehört – die Schuhe aus (ein Mönch vor Ort trägt allerdings welche, ebenso ein Funkgerät, und raucht). Als wir zurückkommen, hat ein Junge zum Vergnügen seiner Freunde meine Gummi-Ballerinas an. Praktisch alle im Dorf leben vom Fischfang. Schon die Jüngsten jagen mit Mini-Speeren die Krabben in den Tümpeln, die die Ebbe zurückgelassen hat. Für die Schulkinder ist heute ein besonderer Tag: Die Schiffseigner und die Stiftung des Reiseveranstalters haben einen Computer mit einem Übersetzungsprogramm birmanisch/englisch und einen Drucker gekauft. Beides wird feierlich dem Direktor überreicht. An der Wand hängt ein Schild: „Building a Modern-developed Nation through Education“. Erst seit kurzem ist der Schulbesuch in Myanmar kostenlos. Nach wie vor ist er keine Pflicht, deshalb sehen viele nicht ein, warum sie gehen sollten. Es ist klar: Myanmar wird sich auch in dieser entlegenen Ecke ändern. Die Tage, in denen nur einmal pro Woche eine Handvoll Touristen vorbeischaut, sind gezählt. Das hinterlässt gemischte Gefühle: Zwar hat die Öffnung des Landes der bisher schwer drangsalierten Bevölkerung sehr geholfen, Touristen bringen Geld in die arme Gegend. Aber ob die traditionelle Kultur den erwarteten Ansturm überlebt?
Wieder an Bord nehme ich meinen Lieblingsplatz in einem der Bugkörbe ein und fühle mich über den Wellen schwebend wie Leonardo DiCaprio in „Titanic“. Zum Glück gibt es hier keine Eisberge! Wir nehmen Kurs auf Lampi Kyun, die größte Insel des Archipels. Abgesehen von Seenomaden, die manchmal dort campen, ist sie unbewohnt. Es gibt sogar Elefanten, die einst von illegalen Holzfällern hergebracht und zum Bäumefällen eingesetzt wurden. Die Holzfäller landeten im Gefängnis, während die Elefanten freigelassen wurden. In der Bucht liegen sieben Fischtrawler die abends hell beleuchtet auslaufen. Mit Seekajaks paddeln wir zum unberührten Strand. Leider herrscht Ebbe, sodass wir zu Fuß in die Mangrovensümpfe laufen müssen. Überall wieseln Krabben, Einsiedlerkrebse. Schlammspringer und kleine Fische herum. Leider kommen am späten Nachmittag die Sandfliegen heraus, die sich hungrig auf uns stürzen. Später versuche ich mich erstmals im Stehpaddeln auf einem Board. Mike macht es vor. Sieht ganz einfach und lässig aus. Meine ersten sechs Versuche, aufzustehen, landen sehr schnell im Wasser. Das Ganze ist viel kippeliger als vermutet. Dann habe ich plötzlich den Bogen raus. Wenn das Board einmal läuft, läuft es. Stolz umrunde ich „Simile“. Später liegen wir in den Beaniebags an Deck und starren stundenlang in den Sternenhimmel. Man hört nur das Plätschern der Wellen an den Strand und das Quaken der Baumfrösche im Dschungel.
Am nächsten Morgen brechen wir früh auf, um Swinton zu erreichen. Für Mike ist es der schönste Ort des Törns: „Wenn ich dort ein anderes Boot liegen sehe, werde ich sauer.“ Am Abend ist ein Barbecue am Strand geplant. Deshalb ist er auf der Jagd. Der dunkle bewegte Fleck auf dem Wasser könnte vom einem Schwarm stammen, der von einem Schwertfisch umkreist wird. Aber der beißt nicht an. Werden wir nur Gemüse grillen können? Dann zieht es plötzlich an einer der beiden Angeln. Mike stoppt den Motor und kurbelt. Ein Wahoo! Der viertschnellste Fisch der Welt ist selbst ein Jäger mit messerscharfen Zähnen – und als exzellenter Speisefisch ein guter Fang. Mike nickt zufrieden: Das Dinner ist gerettet. Nach der Ankunft in Swinton schnorcheln wir erstmal eine Runde. Mike zieht noch einmal mit der Harpune los und bringt u.a. Sweetlips mit, deren Mund stark an Mick Jagger erinnert. Ganz viele Quallen treiben in der Bucht (zum Glück keine Feuerquallen). Wieder liegen in der Nähe sechs Fischerboote. Plötzlich kommt ein Moken-Paar angerudert und schenkt uns Tintenfische. Im Gegenzug bekommen sie Reis. Der ist hier wertvoll wie Gold, erklärt Mike. Den schneeweißen, feinsandigen Strand haben wir ganz für uns. Es sind viele verschiedene Pfoten- und Krallenspuren zu sehen, aber deren Verursacher zeigen sich nicht. Die verstecken sich im dichten Dschungel. Nach Einbruch der Dunkelheit gibt es ein Lagerfeuer. Daneben wird in einem Sandgraben gegrillt.
Am Morgen danach können wir endlich wieder Segel setzen. Teilweise schwappen sogar Wellen über das Vordeck. Wir steuern Macleod an, wo ein kleines Hotel steht. Die erste richtige Dusche seit Tagen! Direkt am Strand und kalt, aber Luxus pur. Das Wasser sprudelt aus einer Quelle, man kann es also unbeschwert laufen lassen. Zwar haben wir einen Wasserbereiter an Bord, der das Meerwasser trinkbar macht. Zu langen Körperreinigungen reicht das Süßwasser jedoch nicht, zumal der „Cleaner“ einen enormen Verbrauch hat. Neben Skipper Mike, dem Guide Cho Cho und dem Koch So gehört nämlich auch Win zur Crew, der seinen Job, das Boot zu putzen, sehr ernst nimmt. „Simile“ ist das sauberste Boot, das ich je gesehen habe. Nach dem Essen wird der Tisch gewischt, unterwegs die Reling abgeseift und poliert. Es ist kein Hightechboot: Wenn das Großsegel gesetzt wird, fassen alle vier das Großfall an und machen Tauziehen.
 Auf dem Weg zum „Myanmar Andaman Resort“ haben meine Mitpassagierin Barb und ich unabhängig voneinander Visionen von Pizza. Ob die wohl auf der Karte steht? Mike lacht: „Das ist ein Luxushotel, das 220 Dollar die Nacht kostet. Was glaubt ihr wohl?“ Es gibt ein Menü für alle. In unserem Fall Algensalat, eine pikante Kürbissuppe und grünes Seafood-Curry. Auch gut – aber verflixt teuer. Sie haben auch Cocktails und Wein zu sehr europäischen Preisen. Die Anlage ist klein: 22 Bungalows, die 2005 so geschickt in die Landschaft eingefügt wurden, dass man sie nur ganz aus der Nähe sehen kann. Es sind kaum Gäste da, wir haben fast alles für uns. Das Resort ist nur Leuten zu empfehlen, die wirklich Ruhe suchen. Zweimal pro Woche bringt das hauseigene Speedboot mit zwei 300-PS-Motoren die Gäste von und nach Kawthoung. Das Ganze gehört einem Geschäftsmann aus Yangon, der sehr gute Regierungskontakte haben muss, und liegt in einer Bucht mit fantastischen Schnorchelmöglichkeiten. Neben den üblichen Verdächtigen (Papageienfische, Seeigel) sehe ich sehr große Anemonenfische, einen riesigen Kofferfisch, eine Meeresschildkröte, einen Cattlefisch (ähnelt einem Tintenfisch) und eine essende Seegurke, die stark an die Biester aus „Im Land der Raketenwürmer“ erinnert. Am nächsten Morgen gehen wir den einzigen vorhandenen Wanderweg: rauf auf den nächsten Hügel. Es ist so steil, dass man sich den letzten Teil an Seilen hochziehen muss. Aber die Aussicht von oben auf die Bucht entschädigt für die Mühen. Anschließend springe ich erstmal in das helltürkise Wasser und gönne mir noch eine Dusche!
Auf dem Weg zum „Myanmar Andaman Resort“ haben meine Mitpassagierin Barb und ich unabhängig voneinander Visionen von Pizza. Ob die wohl auf der Karte steht? Mike lacht: „Das ist ein Luxushotel, das 220 Dollar die Nacht kostet. Was glaubt ihr wohl?“ Es gibt ein Menü für alle. In unserem Fall Algensalat, eine pikante Kürbissuppe und grünes Seafood-Curry. Auch gut – aber verflixt teuer. Sie haben auch Cocktails und Wein zu sehr europäischen Preisen. Die Anlage ist klein: 22 Bungalows, die 2005 so geschickt in die Landschaft eingefügt wurden, dass man sie nur ganz aus der Nähe sehen kann. Es sind kaum Gäste da, wir haben fast alles für uns. Das Resort ist nur Leuten zu empfehlen, die wirklich Ruhe suchen. Zweimal pro Woche bringt das hauseigene Speedboot mit zwei 300-PS-Motoren die Gäste von und nach Kawthoung. Das Ganze gehört einem Geschäftsmann aus Yangon, der sehr gute Regierungskontakte haben muss, und liegt in einer Bucht mit fantastischen Schnorchelmöglichkeiten. Neben den üblichen Verdächtigen (Papageienfische, Seeigel) sehe ich sehr große Anemonenfische, einen riesigen Kofferfisch, eine Meeresschildkröte, einen Cattlefisch (ähnelt einem Tintenfisch) und eine essende Seegurke, die stark an die Biester aus „Im Land der Raketenwürmer“ erinnert. Am nächsten Morgen gehen wir den einzigen vorhandenen Wanderweg: rauf auf den nächsten Hügel. Es ist so steil, dass man sich den letzten Teil an Seilen hochziehen muss. Aber die Aussicht von oben auf die Bucht entschädigt für die Mühen. Anschließend springe ich erstmal in das helltürkise Wasser und gönne mir noch eine Dusche!
Leider müssen wir schon wieder den Anker lichten. Es ist ein langer Weg zurück nach Kawthoung, das wir am letzten Tag sehr früh erreichen müssen, da mein Flug nach Yangon schon kurz nach zehn geht. Es ist der Einzige. Das ist der Grund, warum der Trip zunächst nur noch von Phuket aus angeboten wird. Unser Rückweg ist so lang, weil wie einen Umweg um eine Reihe von Inseln machen müssen, die nach wie vor militärisches Sperrgebiet sind. Zu sehen ist niemand. Nur etwas Rauch steigt auf. Am nächsten Tag allerdings sitzt ein Militärangehöriger mit im Flugzeug. Seine grüne Uniform hat viele bunte Streifen auf der Brust. Die Flip-Flops, die er dazu trägt, trüben den martialischen Eindruck ein wenig. Ist wohl auch ein Ausdruck der neuen Zeit.
Seitenanfang
HOME, SWEET HOME
 Die Fahrt geht zunächst durch sanfte Hügel zwischen saftig grünen Feldern hindurch. Sieht nicht übermäßig exotisch aus. Zum Hlane Nationalpark hin wird es trockener. Dort liegt unser Campingplatz „Ndlovu“ (Elefant). Am Eingang sind Schlingen ausgestellt, mit denen Bewohner der umgebenden Dörfer verbotenerweise wildern wollten. Als wir Mittags ankommen, ist es sehr heiß. Schatten gibt es kaum, weil die kleinen Bäume nur wenige Blätter haben. Hinter dem Restaurant befindet sich ein Wasserloch, das lediglich mit einer Doppelreihe Stacheldraht abgetrennt ist. Ob das im Ernstfall ein unhappy Hippo abhält? Antilopen können ohnehin hindurchschlüpfen.
Die Fahrt geht zunächst durch sanfte Hügel zwischen saftig grünen Feldern hindurch. Sieht nicht übermäßig exotisch aus. Zum Hlane Nationalpark hin wird es trockener. Dort liegt unser Campingplatz „Ndlovu“ (Elefant). Am Eingang sind Schlingen ausgestellt, mit denen Bewohner der umgebenden Dörfer verbotenerweise wildern wollten. Als wir Mittags ankommen, ist es sehr heiß. Schatten gibt es kaum, weil die kleinen Bäume nur wenige Blätter haben. Hinter dem Restaurant befindet sich ein Wasserloch, das lediglich mit einer Doppelreihe Stacheldraht abgetrennt ist. Ob das im Ernstfall ein unhappy Hippo abhält? Antilopen können ohnehin hindurchschlüpfen. Es gibt wegen der Elefanten im Park viele tote Bäume. Dazwischen grasen Impalas mit schwarzen Streifen am Hintern, die ein „M“ formen. „Mac Donald’s für Löwen“, meint Mavela. Die „Big Five“ sehen wir aus unserem Spaziergang nicht, dafür u.a. einen rückwärts laufenden Käfer, der Ameisen fängt und stirbt, wenn er sich paart. Es ist ein „antlion“ , einer der „Small Five“. Die anderen sind „buffalo weaver“, „leopard tortoise“, „elephant screw“ und „rhino beetle“. Daneben gibt es noch die „Ugly Five“: Marabu, Gnu, Hyäne, Geier und Warzenschwein. Mavela würde allerdings lieber statt der Gnus lieber Paviane in die Liste aufnehmen.
Es gibt wegen der Elefanten im Park viele tote Bäume. Dazwischen grasen Impalas mit schwarzen Streifen am Hintern, die ein „M“ formen. „Mac Donald’s für Löwen“, meint Mavela. Die „Big Five“ sehen wir aus unserem Spaziergang nicht, dafür u.a. einen rückwärts laufenden Käfer, der Ameisen fängt und stirbt, wenn er sich paart. Es ist ein „antlion“ , einer der „Small Five“. Die anderen sind „buffalo weaver“, „leopard tortoise“, „elephant screw“ und „rhino beetle“. Daneben gibt es noch die „Ugly Five“: Marabu, Gnu, Hyäne, Geier und Warzenschwein. Mavela würde allerdings lieber statt der Gnus lieber Paviane in die Liste aufnehmen.


 Janosch hat Recht: Panama ist wirklich schön! Wie Costa Rica bietet das relativ kleine Land die Küsten zweier Ozeane mit Hochland dazwischen. Touristisch ist es noch nicht so erschlossen und sehr ursprünglich. Von Puerto Viejo de Talamanca in Costa Rica fahren wir mit einem Minivan durch endlose Bananenplantagen (Chiquita, vormals United Fruit Company) weiter an der Karibikküste entlang nach Sixaola an der Grenze zu Panama, die von einem Fluss gebildet wird. Zu Fuß gehts über eine Brücke nach Guabito. Dort wartet ein anderer Van, der uns nach Almirante bringt. Mit einer Fähre setzen wir zur
Janosch hat Recht: Panama ist wirklich schön! Wie Costa Rica bietet das relativ kleine Land die Küsten zweier Ozeane mit Hochland dazwischen. Touristisch ist es noch nicht so erschlossen und sehr ursprünglich. Von Puerto Viejo de Talamanca in Costa Rica fahren wir mit einem Minivan durch endlose Bananenplantagen (Chiquita, vormals United Fruit Company) weiter an der Karibikküste entlang nach Sixaola an der Grenze zu Panama, die von einem Fluss gebildet wird. Zu Fuß gehts über eine Brücke nach Guabito. Dort wartet ein anderer Van, der uns nach Almirante bringt. Mit einer Fähre setzen wir zur  So erkunde ich den Achipel vom Wasser aus. Am ersten Abend machen wir einen Abstecher nach Bocas Town auf der benachbarten Hauptinsel. Dort befindet sich auch der postkartenmäßige Starfish Beach, der seinem Namen alle Ehre macht. Überall liegen große orangene und gelbe Seesterne im Sand. Die Delphine in der Dolphin Bay zeigen sich leider nur kurz. Wunderschön sind die Isla Zapatilla Norte im Nationalpark östlich der Isla Bastimentos und der Felsen Bird Island nördlich der Hauptinsel, wo Weißbauchtölpel, Rotschnabel-Tropikvögel, Prachtfregattvögel und Braunpelikane leben. Eine besondere Vogelbegegnung haben wir in einem Hotel am Ostende der Isla Bastimentos. Am Ende des Steges hocken zwei rote Aras am Weg, die miteinander schmusen. Dann hüpfen sie hinter eine kleine Hütte und gucken neugierig um die Ecke. Als eine Mitreisende einen Schritt auf die Papageien zugeht, um ein Foto zu machen, schnellt einer hervor und hackt ihr ohne Vorwarnung in den Fuß. Kurz darauf greift er einen Mann an, der an ihm vorbeilaufen will. Später erfahren wir, dass er als gefiederter Wachhund berühmt-berüchtigt ist. Ein echtes Übel-Geflügel! Direkt bei dem Hotel kann man in den Mangroven schnorcheln. In der Nähe befindet sich ein Unterwasser-Garten mit einer unglaublich bunten Vielfalt an Korallen.
So erkunde ich den Achipel vom Wasser aus. Am ersten Abend machen wir einen Abstecher nach Bocas Town auf der benachbarten Hauptinsel. Dort befindet sich auch der postkartenmäßige Starfish Beach, der seinem Namen alle Ehre macht. Überall liegen große orangene und gelbe Seesterne im Sand. Die Delphine in der Dolphin Bay zeigen sich leider nur kurz. Wunderschön sind die Isla Zapatilla Norte im Nationalpark östlich der Isla Bastimentos und der Felsen Bird Island nördlich der Hauptinsel, wo Weißbauchtölpel, Rotschnabel-Tropikvögel, Prachtfregattvögel und Braunpelikane leben. Eine besondere Vogelbegegnung haben wir in einem Hotel am Ostende der Isla Bastimentos. Am Ende des Steges hocken zwei rote Aras am Weg, die miteinander schmusen. Dann hüpfen sie hinter eine kleine Hütte und gucken neugierig um die Ecke. Als eine Mitreisende einen Schritt auf die Papageien zugeht, um ein Foto zu machen, schnellt einer hervor und hackt ihr ohne Vorwarnung in den Fuß. Kurz darauf greift er einen Mann an, der an ihm vorbeilaufen will. Später erfahren wir, dass er als gefiederter Wachhund berühmt-berüchtigt ist. Ein echtes Übel-Geflügel! Direkt bei dem Hotel kann man in den Mangroven schnorcheln. In der Nähe befindet sich ein Unterwasser-Garten mit einer unglaublich bunten Vielfalt an Korallen. Weiter gehts von Almirante aus mit einem Minibus Richtung Süden. Die kurvige Straße windet sich in die Berge, ein Faultier kriecht über die Fahrbahn. Der Kühler des ältlichen Wagens beginnt zu kochen. Nach einer Verschnaufpause schafft er es doch noch über den Pass. In der Kleinstadt
Weiter gehts von Almirante aus mit einem Minibus Richtung Süden. Die kurvige Straße windet sich in die Berge, ein Faultier kriecht über die Fahrbahn. Der Kühler des ältlichen Wagens beginnt zu kochen. Nach einer Verschnaufpause schafft er es doch noch über den Pass. In der Kleinstadt  Bei der Abfahrt sitzt am Haupteingang eine Motte, die so groß wie meine Hand ist. Ihre Flügel wackeln im Wind, Es sieht fast so aus, als würde sie uns hinterherwinken. Wieder steigen wir in Boquete in einen Minivan um. Bei einem Abstecher in den Supermarkt will ich für abends eine kleine Flasche Wein und eine Einmalportion Pringles erstehen. Die Verkäuferin zeigt auf den Wein und sagt etwas, von dem ich nur „diez“ und „liquor“ verstehe. Muss man mindestens zehn sein, um hier Alkohol zu kaufen? Will sie meinen Ausweis sehen? Ein Kollege kommt hinzu und übersetzt, dass man vor zehn Uhr morgens keinen Alkohol bekommen kann. Blick auf die Uhr: zehn vor zehn. Also nur die Pringles. Der australische Mitreisende hinter mir muss sein Bier stehenlassen. Unser Guide Vin erklärt uns, dass der Supermarkt erzkonservativen Evangelikalen gehört. Ohnehin gibt es in Panama schräge Sitten. Am Nationalfeiertag, der drei Tage dauert, wird gar kein Alkohol verkauft, was er auch nicht wusste – „war eine trockene Angelegenheit“. Vin stammt aus
Bei der Abfahrt sitzt am Haupteingang eine Motte, die so groß wie meine Hand ist. Ihre Flügel wackeln im Wind, Es sieht fast so aus, als würde sie uns hinterherwinken. Wieder steigen wir in Boquete in einen Minivan um. Bei einem Abstecher in den Supermarkt will ich für abends eine kleine Flasche Wein und eine Einmalportion Pringles erstehen. Die Verkäuferin zeigt auf den Wein und sagt etwas, von dem ich nur „diez“ und „liquor“ verstehe. Muss man mindestens zehn sein, um hier Alkohol zu kaufen? Will sie meinen Ausweis sehen? Ein Kollege kommt hinzu und übersetzt, dass man vor zehn Uhr morgens keinen Alkohol bekommen kann. Blick auf die Uhr: zehn vor zehn. Also nur die Pringles. Der australische Mitreisende hinter mir muss sein Bier stehenlassen. Unser Guide Vin erklärt uns, dass der Supermarkt erzkonservativen Evangelikalen gehört. Ohnehin gibt es in Panama schräge Sitten. Am Nationalfeiertag, der drei Tage dauert, wird gar kein Alkohol verkauft, was er auch nicht wusste – „war eine trockene Angelegenheit“. Vin stammt aus  Auf dem Weg nach Südosten wird die Gegend trockener. Auf sonnenverbrannten Grasflächen stehen viele Rinder. Schließlich erreichen wir das Örtchen
Auf dem Weg nach Südosten wird die Gegend trockener. Auf sonnenverbrannten Grasflächen stehen viele Rinder. Schließlich erreichen wir das Örtchen  Die Panamericana bringt uns schließlich in die Hauptstadt, die viel schöner ist, als erwartet. Unterwegs machen wir einen Abstecher zu den „Miraflores Locks“. Bei den Schleusen auf der Pazifikseite des berühmten Kanals befindet sich ein Museum mit Aussichtsterrasse. Wir sehen gerade noch, wie ein Frachtschiff, das rechts und links nur ein paar Zentimeter Platz hat, sich herauswindet. Ich stelle mir vor, wie es sich für Weltumsegler anfühlen muss, mitgeschleust zu werden. Nebenan entstehen neue Schleusen für ganz große Pötte, die eigentlich im Januar eingeweiht werden sollten. Streiks haben das verhindert. Jetzt sollen sie im Mai eröffnet werden… Der bisherige Kanal ist zwischen 1903 und 1914 von 45.000 Menschen gebaut worden. Die Erweiterung ist die derzeit größte Baustelle der Welt.
Die Panamericana bringt uns schließlich in die Hauptstadt, die viel schöner ist, als erwartet. Unterwegs machen wir einen Abstecher zu den „Miraflores Locks“. Bei den Schleusen auf der Pazifikseite des berühmten Kanals befindet sich ein Museum mit Aussichtsterrasse. Wir sehen gerade noch, wie ein Frachtschiff, das rechts und links nur ein paar Zentimeter Platz hat, sich herauswindet. Ich stelle mir vor, wie es sich für Weltumsegler anfühlen muss, mitgeschleust zu werden. Nebenan entstehen neue Schleusen für ganz große Pötte, die eigentlich im Januar eingeweiht werden sollten. Streiks haben das verhindert. Jetzt sollen sie im Mai eröffnet werden… Der bisherige Kanal ist zwischen 1903 und 1914 von 45.000 Menschen gebaut worden. Die Erweiterung ist die derzeit größte Baustelle der Welt. Perfektes Timing: Wir erreichen
Perfektes Timing: Wir erreichen 




 Ebenfalls fantastisch sind die Menschen. Das merke ich noch einmal, als ich zum Flughafen muss. Am nächsten Tag ist Nationalfeiertag, der Präsident besucht Ponta Delgada und die Innenstadt ist schon gesperrt. So kommt das bestellte Taxi im Verkehrschaos nicht zum zentral gelegenen Hotel Camoes durch. Ich irre mit meinem Gepäck Richtung Hafen, wo ich eine Gruppe Polizisten und Offizielle sehe. Als ich verzweifelt frage, was ich tun soll, erbarmt sich einer der Polizisten und fährt mich mit einem Kollegen im Streifenwagen hin.
Ebenfalls fantastisch sind die Menschen. Das merke ich noch einmal, als ich zum Flughafen muss. Am nächsten Tag ist Nationalfeiertag, der Präsident besucht Ponta Delgada und die Innenstadt ist schon gesperrt. So kommt das bestellte Taxi im Verkehrschaos nicht zum zentral gelegenen Hotel Camoes durch. Ich irre mit meinem Gepäck Richtung Hafen, wo ich eine Gruppe Polizisten und Offizielle sehe. Als ich verzweifelt frage, was ich tun soll, erbarmt sich einer der Polizisten und fährt mich mit einem Kollegen im Streifenwagen hin.






















































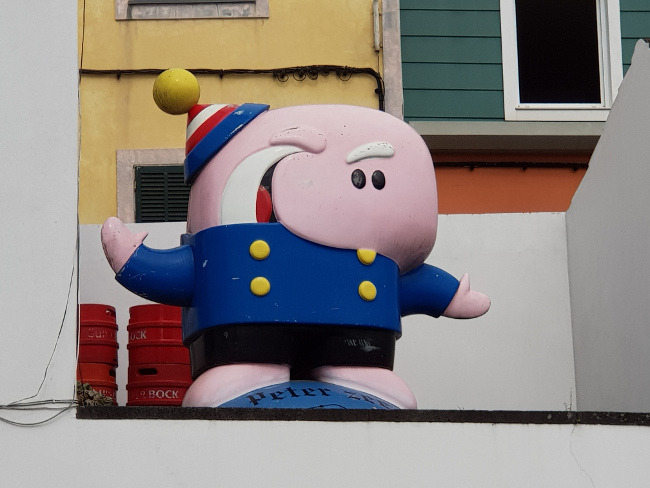





















































































 Das ist das Schöne am Reisen: Man erlebt immer wieder Überraschungen, aber manches ist auch genauso, wie man es sich vorgestellt hat!
Das ist das Schöne am Reisen: Man erlebt immer wieder Überraschungen, aber manches ist auch genauso, wie man es sich vorgestellt hat!
 Zwar leben wir weitgehend im Staub – Wasser sehen wir auf unserer Reise trotzdem jede Menge. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste See im Land? Das ist wirklich unmöglich zu sagen. Die spektakulärsten Farben haben sicherlich Gletscherseen wie Lake Peyto am Icefields Parkway und Lake Louise im Banff National Park. Aus den Felsen gespülte Sedimente lassen das Wasser in einem unglaublichen Türkis schimmern. Dafür sind diese Seen eiskalt. Lac Beauvert bei Jasper, der Clearwater Lake im Wells Gray Provincial Park oder Pinantan Lake in der Nähe von Kamloops hingegen erreichen im Sommer durchaus angenehme Temperaturen und sind perfekt zum Schwimmen geeignet. Das Wasser im Clearwater Lake ist so sauber, dass man es direkt trinken kann. Ungewohnt! Das würde ich mir auf der Hamburger Außenalster verkneifen…
Zwar leben wir weitgehend im Staub – Wasser sehen wir auf unserer Reise trotzdem jede Menge. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste See im Land? Das ist wirklich unmöglich zu sagen. Die spektakulärsten Farben haben sicherlich Gletscherseen wie Lake Peyto am Icefields Parkway und Lake Louise im Banff National Park. Aus den Felsen gespülte Sedimente lassen das Wasser in einem unglaublichen Türkis schimmern. Dafür sind diese Seen eiskalt. Lac Beauvert bei Jasper, der Clearwater Lake im Wells Gray Provincial Park oder Pinantan Lake in der Nähe von Kamloops hingegen erreichen im Sommer durchaus angenehme Temperaturen und sind perfekt zum Schwimmen geeignet. Das Wasser im Clearwater Lake ist so sauber, dass man es direkt trinken kann. Ungewohnt! Das würde ich mir auf der Hamburger Außenalster verkneifen… Obwohl wir zwei Wochen unterwegs sind, sehe ich nur einen ziemlich kleinen Teil des riesigen Kanadas. Die Einheimischen nennen den Südwesten wegen seines vergleichsweise milden Klimas „Banana Belt“. Dort wächst immerhin Wein. Ausgangs- und Endpunkt meiner Reise ist
Obwohl wir zwei Wochen unterwegs sind, sehe ich nur einen ziemlich kleinen Teil des riesigen Kanadas. Die Einheimischen nennen den Südwesten wegen seines vergleichsweise milden Klimas „Banana Belt“. Dort wächst immerhin Wein. Ausgangs- und Endpunkt meiner Reise ist 

 In Whistler mache ich wieder einmal Ziplining. Luxus: Mit der „Peak To Peak“-Gondel fahren wir zur Mittelstation des Whistler Mountain, also kein Hochkraxeln zum Start. Bremsen muss man auch nicht selbst. Das machen die Guides. Neben uns rasen Mountainbiker bergab und springen über Schanzen. Der Lift, der im Winter die Skifahrer zu den Pisten transportiert, schaufelt jetzt sie den Berg hinauf. Umgebaute Sessel halten die Fahrräder.
In Whistler mache ich wieder einmal Ziplining. Luxus: Mit der „Peak To Peak“-Gondel fahren wir zur Mittelstation des Whistler Mountain, also kein Hochkraxeln zum Start. Bremsen muss man auch nicht selbst. Das machen die Guides. Neben uns rasen Mountainbiker bergab und springen über Schanzen. Der Lift, der im Winter die Skifahrer zu den Pisten transportiert, schaufelt jetzt sie den Berg hinauf. Umgebaute Sessel halten die Fahrräder. Im Wells Gray Provincial Park übernachten wir auf einer Guest Ranch. Besitzer Mike trägt Bart, Cowboyhut und ist ein waschechter – Österreicher! Morgens packen wir die Sachen, fahren zum Clearwater Lake und steigen vom Truck in Kanus um. Unser Paddel-Guide Kevin hat ein T-Shirt mit der Aufschrift „Vegetarian: Indian word for lousy hunter“ an, ist ein Nachfahre von Pionieren, auf einer Ranch aufgewachsen und früher Rodeos geritten. Außerdem spielte er in einer Countryband Gitarre, bis er mit der rechten Hand in eine Säge kam. Die Landschaft ist völlig unberührt und dicht bewaldet. Vor allem mit ganz schlanken Nadelbäumen, die nicht wie die europäischen von unten, sondern von oben absterben. Die einzige Straße endet am Bootsanleger. Sonst ist das Ufer nur vom Boot aus zu erreichen, ebenso wie unser Campingplatz Diver’s Bluff. Der erste Weiße hat die Gegend erst 1921 betreten. Auch die Indianer haben hier nicht gelebt, sondern gejagt. Die einen kamen von Süden, die anderen von Norden. Am Battle Mountain haben sie sich regelmäßig getroffen und skalpiert. Denn die Verlierer der Schlacht mussten in schlechtere Jagdgründe ausweichen und hatten einen harten Winter.
Im Wells Gray Provincial Park übernachten wir auf einer Guest Ranch. Besitzer Mike trägt Bart, Cowboyhut und ist ein waschechter – Österreicher! Morgens packen wir die Sachen, fahren zum Clearwater Lake und steigen vom Truck in Kanus um. Unser Paddel-Guide Kevin hat ein T-Shirt mit der Aufschrift „Vegetarian: Indian word for lousy hunter“ an, ist ein Nachfahre von Pionieren, auf einer Ranch aufgewachsen und früher Rodeos geritten. Außerdem spielte er in einer Countryband Gitarre, bis er mit der rechten Hand in eine Säge kam. Die Landschaft ist völlig unberührt und dicht bewaldet. Vor allem mit ganz schlanken Nadelbäumen, die nicht wie die europäischen von unten, sondern von oben absterben. Die einzige Straße endet am Bootsanleger. Sonst ist das Ufer nur vom Boot aus zu erreichen, ebenso wie unser Campingplatz Diver’s Bluff. Der erste Weiße hat die Gegend erst 1921 betreten. Auch die Indianer haben hier nicht gelebt, sondern gejagt. Die einen kamen von Süden, die anderen von Norden. Am Battle Mountain haben sie sich regelmäßig getroffen und skalpiert. Denn die Verlierer der Schlacht mussten in schlechtere Jagdgründe ausweichen und hatten einen harten Winter. In Golden raften wir auf der mittleren und unteren Sektion des Kicking Horse Rivers, der seinem Namen alle Ehre macht und fleißig um sich tritt. Das Wasser hat nur 3 Grad. Das letzte Mal war es vor 10.000 Jahren wärmer. Etwas zu spät gekommen… Immerhin gibts Neoprenanzüge für alle.
In Golden raften wir auf der mittleren und unteren Sektion des Kicking Horse Rivers, der seinem Namen alle Ehre macht und fleißig um sich tritt. Das Wasser hat nur 3 Grad. Das letzte Mal war es vor 10.000 Jahren wärmer. Etwas zu spät gekommen… Immerhin gibts Neoprenanzüge für alle. Am ersten Tag besuche ich das Vancouver Aquarium. Meine Favoriten sind die unglaublich putzigen Seeotter, ein riesiger orangefarbener Krake und die beiden Belugas, die in einer Show gezeigt werden. Sonst bekomme ich keine Meerestiere zu Gesicht, da wir nur kurz die Pazifikküste hochfahren, bevor wir Richtung Rocky Mountains nach Osten abbiegen.
Am ersten Tag besuche ich das Vancouver Aquarium. Meine Favoriten sind die unglaublich putzigen Seeotter, ein riesiger orangefarbener Krake und die beiden Belugas, die in einer Show gezeigt werden. Sonst bekomme ich keine Meerestiere zu Gesicht, da wir nur kurz die Pazifikküste hochfahren, bevor wir Richtung Rocky Mountains nach Osten abbiegen.

 Nachdem ich mir im Skiurlaub 2014 das rechte Knie zerlegt hatte, war ich fast ein Jahr lang nicht reisefähig. Im März 2015 hebe ich endlich wieder ab, lasse es allerdings schön langsam angehen: Segeln in der Karibik! Über Amsterdam fliege ich zunächst nach St. Maarten. Nach neuneinhalb Stunden in der Luft befinde ich mich immer noch auf niederländischem Boden. Irgendwie. Am Flughafen schnüffeln Hunde. Einer schlägt bei meinem Handtäschchen an. Er sucht nicht etwa Drogen. „Wieviel Bargeld haben Sie dabei?“, fragt der Zöllner.
Nachdem ich mir im Skiurlaub 2014 das rechte Knie zerlegt hatte, war ich fast ein Jahr lang nicht reisefähig. Im März 2015 hebe ich endlich wieder ab, lasse es allerdings schön langsam angehen: Segeln in der Karibik! Über Amsterdam fliege ich zunächst nach St. Maarten. Nach neuneinhalb Stunden in der Luft befinde ich mich immer noch auf niederländischem Boden. Irgendwie. Am Flughafen schnüffeln Hunde. Einer schlägt bei meinem Handtäschchen an. Er sucht nicht etwa Drogen. „Wieviel Bargeld haben Sie dabei?“, fragt der Zöllner.  Den Strand in St. Maarten „zieren“ Hochhäuser, überhaupt scheint die Insel ziemlich dicht bebaut zu sein. Tortola, die Hauptinsel der BVI hingegen sieht schon von oben verheißungsvoller aus. Nach der Landung auf dem Flughafen im benachbarten Beef Island fahre ich mit dem Taxi über eine Brücke an die Südküste in die Hauptstadt
Den Strand in St. Maarten „zieren“ Hochhäuser, überhaupt scheint die Insel ziemlich dicht bebaut zu sein. Tortola, die Hauptinsel der BVI hingegen sieht schon von oben verheißungsvoller aus. Nach der Landung auf dem Flughafen im benachbarten Beef Island fahre ich mit dem Taxi über eine Brücke an die Südküste in die Hauptstadt 
 Mein Zuhause für den Segeltörn ist ein 44 Fuß langes Boot von Fountaine Pajot mit vier erstaunlich großen Kabinen, von denen jede ein eigenes Bad hat. Weil wir nur vier Passagiere sind, müssen wir nicht mal teilen. „I am Free“ – der Name ist Programm. Weniger passend hingegen wurde der „Bitter End Yacht Club“ auf Virgin Gorda getauft – ist eigentlich mehr ein „Happy End“. Auch die Traumbuchten „White Bay“ auf Guana Island und „White Bay“ auf Jost Van Dyke hätten originellere Bezeichnungen verdient. Sehr kreativ dagegen finde ich „De Loose Mangoose“. So heißt das Restaurant auf der Flughafeninsel
Mein Zuhause für den Segeltörn ist ein 44 Fuß langes Boot von Fountaine Pajot mit vier erstaunlich großen Kabinen, von denen jede ein eigenes Bad hat. Weil wir nur vier Passagiere sind, müssen wir nicht mal teilen. „I am Free“ – der Name ist Programm. Weniger passend hingegen wurde der „Bitter End Yacht Club“ auf Virgin Gorda getauft – ist eigentlich mehr ein „Happy End“. Auch die Traumbuchten „White Bay“ auf Guana Island und „White Bay“ auf Jost Van Dyke hätten originellere Bezeichnungen verdient. Sehr kreativ dagegen finde ich „De Loose Mangoose“. So heißt das Restaurant auf der Flughafeninsel 













 Nur Bares ist Wahres. Kreditkarten werden nirgendwo akzeptiert. FALSCH! Das Land verändert sich so schnell, dass Anfang 2014 die Angaben in 2013 erschienenen Reiseführern schon nicht mehr stimmen. Inzwischen steht selbst mitten in Yangons Shwedagon Pagode ein Geldautomat, der die Landeswährung Kyat ausspuckt. Lediglich auf dem Land sind makellose Dollar-Noten (seltsamerweise am liebsten 100er, für die gibt es einen besseren Kurs als für kleine Scheine) für den Umtausch nach wie unverzichtbar. Unerwartet habe ich an vielen Orten Internet-Zugang via W-LAN, komme problemlos an meine E-Mails. Nicht die einzige Überraschung: Bis vor kurzem durfte man weder Handys noch Presseprodukte nach Myanmar einführen. Jetzt wundert sich die Reisegruppe über einen Straßenstand mit Massen von Zeitungen und Zeitschriften, die Namen wie „Democracy“ tragen. „Die Pressezensur wurde abgeschafft“, erklärt unser Guide Louis, „60 Prozent des Inhalts bestehen aus Politik. Die Leute interessieren sich brennend dafür“. 2015 stehen (hoffentlich freie) Wahlen an. Louis kann jetzt offen sagen, dass er die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi unterstützt und uns ihr Haus zeigen. Früher undenkbar. Seit die Militärs 2011 nach rund 50 Jahren Diktatur einen zivilen Präsidenten als Staatsoberhaupt einsetzten, befindet sich das Land im Aufbruch. Überall wird gebaut, gestrichen (Bordsteine weißrot) und ordentlich gepflanzt. Auch die ursprünglich für den Abriss vorgesehenen Kolonialgebäude im Zentrum der ehemaligen Hauptstadt Yangon sollen erhalten werden.
Nur Bares ist Wahres. Kreditkarten werden nirgendwo akzeptiert. FALSCH! Das Land verändert sich so schnell, dass Anfang 2014 die Angaben in 2013 erschienenen Reiseführern schon nicht mehr stimmen. Inzwischen steht selbst mitten in Yangons Shwedagon Pagode ein Geldautomat, der die Landeswährung Kyat ausspuckt. Lediglich auf dem Land sind makellose Dollar-Noten (seltsamerweise am liebsten 100er, für die gibt es einen besseren Kurs als für kleine Scheine) für den Umtausch nach wie unverzichtbar. Unerwartet habe ich an vielen Orten Internet-Zugang via W-LAN, komme problemlos an meine E-Mails. Nicht die einzige Überraschung: Bis vor kurzem durfte man weder Handys noch Presseprodukte nach Myanmar einführen. Jetzt wundert sich die Reisegruppe über einen Straßenstand mit Massen von Zeitungen und Zeitschriften, die Namen wie „Democracy“ tragen. „Die Pressezensur wurde abgeschafft“, erklärt unser Guide Louis, „60 Prozent des Inhalts bestehen aus Politik. Die Leute interessieren sich brennend dafür“. 2015 stehen (hoffentlich freie) Wahlen an. Louis kann jetzt offen sagen, dass er die Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi unterstützt und uns ihr Haus zeigen. Früher undenkbar. Seit die Militärs 2011 nach rund 50 Jahren Diktatur einen zivilen Präsidenten als Staatsoberhaupt einsetzten, befindet sich das Land im Aufbruch. Überall wird gebaut, gestrichen (Bordsteine weißrot) und ordentlich gepflanzt. Auch die ursprünglich für den Abriss vorgesehenen Kolonialgebäude im Zentrum der ehemaligen Hauptstadt Yangon sollen erhalten werden. Immer mehr Touristen besuchen Myanmar. An abgelegeneren Orten sind Fremde allerdings noch eine Attraktion. Zweimal sprechen mich an einem Wasserfall bei Pyin U Lwin Einheimische an, die sich mit mir fotografieren lassen wollen. Darunter ist auch ein junger Mönch mit seiner kompletten Familie, inkl. Oma. Unterwegs halten wir einmal in einem Dorf, in dem gerade ein Pagodenfestival stattfindet. Leider ist das Ochsenkarren-Rennen schon vorbei. Auch der Gesangswettbewerb mit traditionellen birmanischen Liedern neigt sich dem Ende zu. Während der letzte Teilnehmer singt, dreht sich das Publikum plötzlich um und blickt uns an. Eine ältere Frau nähert sich und befühlt die schneeweiße Haut einer englischen Mitreisenden. In der Stadt Kawthoung im äußersten Süden errege ich ebenfalls weit mehr Aufmerksamkeit, als mir lieb ist. Beim Bummel durch die Straßen folgen mir alle Augen. Ein kleiner Junge kommt sogar aus einem Haus angelaufen und überreicht mir feierlich eine Mango. „She su be (danke)!“ Damit habe ich ein Drittel meines birmanischen Wortschatzes angebracht. (Die Begrüßung „Mingalaba“ und die Abschiedsflokel „Tata“ sind der Rest). „Take care of tourists“, mahnt ein Schild die Einheimischen. Etwas doppeldeutig. Wenn nicht jeder, der mir entgegenkommt, so freundlich grüßen würde, wäre es mir unheimlich… Auf einem Felsen am Hafen befindet sich ein hübscher Park mit einer martialischen Statue von einem früheren König, der gerne mal im nahen Thailand eingefallen ist. Ich suche mir ein schattiges Plätzchen unter einem kieferartigen Baum. Auf einmal fühle ich, dass ich beobachtet werde. Vier Jungs sehen mich mit unverhohlener Neugier an. Ich denke: „Hey, ich bin die Touristin. Es ist mein Job, Leute anzustarren.“ Wieder bringe ich meinen Wortschatz an.
Immer mehr Touristen besuchen Myanmar. An abgelegeneren Orten sind Fremde allerdings noch eine Attraktion. Zweimal sprechen mich an einem Wasserfall bei Pyin U Lwin Einheimische an, die sich mit mir fotografieren lassen wollen. Darunter ist auch ein junger Mönch mit seiner kompletten Familie, inkl. Oma. Unterwegs halten wir einmal in einem Dorf, in dem gerade ein Pagodenfestival stattfindet. Leider ist das Ochsenkarren-Rennen schon vorbei. Auch der Gesangswettbewerb mit traditionellen birmanischen Liedern neigt sich dem Ende zu. Während der letzte Teilnehmer singt, dreht sich das Publikum plötzlich um und blickt uns an. Eine ältere Frau nähert sich und befühlt die schneeweiße Haut einer englischen Mitreisenden. In der Stadt Kawthoung im äußersten Süden errege ich ebenfalls weit mehr Aufmerksamkeit, als mir lieb ist. Beim Bummel durch die Straßen folgen mir alle Augen. Ein kleiner Junge kommt sogar aus einem Haus angelaufen und überreicht mir feierlich eine Mango. „She su be (danke)!“ Damit habe ich ein Drittel meines birmanischen Wortschatzes angebracht. (Die Begrüßung „Mingalaba“ und die Abschiedsflokel „Tata“ sind der Rest). „Take care of tourists“, mahnt ein Schild die Einheimischen. Etwas doppeldeutig. Wenn nicht jeder, der mir entgegenkommt, so freundlich grüßen würde, wäre es mir unheimlich… Auf einem Felsen am Hafen befindet sich ein hübscher Park mit einer martialischen Statue von einem früheren König, der gerne mal im nahen Thailand eingefallen ist. Ich suche mir ein schattiges Plätzchen unter einem kieferartigen Baum. Auf einmal fühle ich, dass ich beobachtet werde. Vier Jungs sehen mich mit unverhohlener Neugier an. Ich denke: „Hey, ich bin die Touristin. Es ist mein Job, Leute anzustarren.“ Wieder bringe ich meinen Wortschatz an. Emanzipiert? Die Terrasse der Shwedagon Pagode dürfen Frauen nicht betreten, andere Heiligtümer wie den Goldenen Fels bei Bago und Mönche nicht berühren. Viele der inbrünstig Betenden sind weiblich: Sie wollen nicht etwa Schönheit oder Reichtum, sondern im nächsten Leben als Mann wiedergeboren werden. Frauen können nämlich nicht erleuchtet werden und das Nirwana erreichen, müssen also in jedem Fall noch mindestens eine Runde auf der Erde drehen. Tolerant? In Mandalay sehen wir einmal eine Prozession von Indern vorbeikommen, die Buddha und eine Hindu-Gottheit tragen. Moslems dürften auf der Straße nicht so einen Krach machen, erklärt Louis. Im Rakhaing-Staat kommt es mit der moslemischen Minderheit der Rohingya sogar zu brügerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Friedfertig? In
Emanzipiert? Die Terrasse der Shwedagon Pagode dürfen Frauen nicht betreten, andere Heiligtümer wie den Goldenen Fels bei Bago und Mönche nicht berühren. Viele der inbrünstig Betenden sind weiblich: Sie wollen nicht etwa Schönheit oder Reichtum, sondern im nächsten Leben als Mann wiedergeboren werden. Frauen können nämlich nicht erleuchtet werden und das Nirwana erreichen, müssen also in jedem Fall noch mindestens eine Runde auf der Erde drehen. Tolerant? In Mandalay sehen wir einmal eine Prozession von Indern vorbeikommen, die Buddha und eine Hindu-Gottheit tragen. Moslems dürften auf der Straße nicht so einen Krach machen, erklärt Louis. Im Rakhaing-Staat kommt es mit der moslemischen Minderheit der Rohingya sogar zu brügerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Friedfertig? In  Beim Besuch von Tempeln, Pagoden, Heiligtümern und Klöstern erscheint für Außenstehende manches widersprüchlich oder skurril: Schuhe müssen grundsätzlich draußenbleiben. Vor dem Betreten muss man sie ausziehen und stehenlassen. Auch die Socken. (Was ist eigentlich, wenn einer einen Gips trägt?) Da kennen die Buddhisten keine Gnade, selbst wenn es schneit. Als wir die Höhlen von
Beim Besuch von Tempeln, Pagoden, Heiligtümern und Klöstern erscheint für Außenstehende manches widersprüchlich oder skurril: Schuhe müssen grundsätzlich draußenbleiben. Vor dem Betreten muss man sie ausziehen und stehenlassen. Auch die Socken. (Was ist eigentlich, wenn einer einen Gips trägt?) Da kennen die Buddhisten keine Gnade, selbst wenn es schneit. Als wir die Höhlen von  Neben der Religion spielt der Glaube an Geister eine wichtige Rolle. Der Übergang ist fließend. Die sogenannten Nats wurden genormt, auf 37 reduziert und in den Buddhismus integriert. Sie lassen sich wohl ganz gut mit den katholischen Heiligen vergleichen. In der Regel sind es reale Personen, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Die meisten sind Frauen (sind eher geeignet als böse Geister herumzuspuken). Ihr Zentrum ist
Neben der Religion spielt der Glaube an Geister eine wichtige Rolle. Der Übergang ist fließend. Die sogenannten Nats wurden genormt, auf 37 reduziert und in den Buddhismus integriert. Sie lassen sich wohl ganz gut mit den katholischen Heiligen vergleichen. In der Regel sind es reale Personen, die eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Die meisten sind Frauen (sind eher geeignet als böse Geister herumzuspuken). Ihr Zentrum ist  „Overpagodaed“ oder „templed out“ heißt es auf Englisch, wenn Touristen genug vom Heiligen Bimbam haben. Tatsächlich gibt es in Myanmar noch weit mehr zu entdecken. Start-, End- und Mittelpunkt meiner Rundreise ist die ehemalige Hauptstadt
„Overpagodaed“ oder „templed out“ heißt es auf Englisch, wenn Touristen genug vom Heiligen Bimbam haben. Tatsächlich gibt es in Myanmar noch weit mehr zu entdecken. Start-, End- und Mittelpunkt meiner Rundreise ist die ehemalige Hauptstadt  Auf dem Ayeyarwady fahren wir mit einem Holzboot namens Shwe Naingngan (goldenes Land), das nur ca. 1,50 Meter Tiefgang hat, von Bagan nach
Auf dem Ayeyarwady fahren wir mit einem Holzboot namens Shwe Naingngan (goldenes Land), das nur ca. 1,50 Meter Tiefgang hat, von Bagan nach  Weiter geht es aus der staubigen Zentralebene hoch in die Berge des Shan-Staates. Wir befinden uns jetzt im Goldenen Dreieck. Offiziell sind Drogen streng verboten, aber Regierungsmitglieder bauen sie selbst an. Bei langen Nachtfahrten dopen sich die Trucker gerne, indem sie Amphetamin rauchen, erklärt unser Tourguide Louis. Dann brettern sie mit altersschwachen Lkw über die gewundene, enge Straße. Wer die Droge in Pillenform kaufen will, gibt das mit einer simplen Handgeste zu verstehen: Zeige-, Mittel- und Ringfinger hoch, Daumen und kleiner Finger als Kreis, sodass die Kuppe des kleinen Fingers wie eine Pille übersteht. Myanmar ist mittlerweile vor Afghanistan der weltgrößte Drogenproduzent.
Weiter geht es aus der staubigen Zentralebene hoch in die Berge des Shan-Staates. Wir befinden uns jetzt im Goldenen Dreieck. Offiziell sind Drogen streng verboten, aber Regierungsmitglieder bauen sie selbst an. Bei langen Nachtfahrten dopen sich die Trucker gerne, indem sie Amphetamin rauchen, erklärt unser Tourguide Louis. Dann brettern sie mit altersschwachen Lkw über die gewundene, enge Straße. Wer die Droge in Pillenform kaufen will, gibt das mit einer simplen Handgeste zu verstehen: Zeige-, Mittel- und Ringfinger hoch, Daumen und kleiner Finger als Kreis, sodass die Kuppe des kleinen Fingers wie eine Pille übersteht. Myanmar ist mittlerweile vor Afghanistan der weltgrößte Drogenproduzent. Bevor wir weiterfahren, bummeln wir über den großen Markt von Kalaw, der nur alle fünf Tage stattfindet. Von einem der Verkaufsstände bietet uns Louis einen Snack an. Es schmeckt nach Knoblauch und Chili und etwas säuerlich. Geröstete Ameisen! Im Shan-Staat essen sie auch Hunde (aber nur die Schwarzen). Unsere nächste Station ist
Bevor wir weiterfahren, bummeln wir über den großen Markt von Kalaw, der nur alle fünf Tage stattfindet. Von einem der Verkaufsstände bietet uns Louis einen Snack an. Es schmeckt nach Knoblauch und Chili und etwas säuerlich. Geröstete Ameisen! Im Shan-Staat essen sie auch Hunde (aber nur die Schwarzen). Unsere nächste Station ist 
 Wir ankern vor der Insel
Wir ankern vor der Insel  Auf dem Weg zum „Myanmar Andaman Resort“ haben meine Mitpassagierin Barb und ich unabhängig voneinander Visionen von Pizza. Ob die wohl auf der Karte steht? Mike lacht: „Das ist ein Luxushotel, das 220 Dollar die Nacht kostet. Was glaubt ihr wohl?“ Es gibt ein Menü für alle. In unserem Fall Algensalat, eine pikante Kürbissuppe und grünes Seafood-Curry. Auch gut – aber verflixt teuer. Sie haben auch Cocktails und Wein zu sehr europäischen Preisen. Die Anlage ist klein: 22 Bungalows, die 2005 so geschickt in die Landschaft eingefügt wurden, dass man sie nur ganz aus der Nähe sehen kann. Es sind kaum Gäste da, wir haben fast alles für uns. Das Resort ist nur Leuten zu empfehlen, die wirklich Ruhe suchen. Zweimal pro Woche bringt das hauseigene Speedboot mit zwei 300-PS-Motoren die Gäste von und nach Kawthoung. Das Ganze gehört einem Geschäftsmann aus Yangon, der sehr gute Regierungskontakte haben muss, und liegt in einer Bucht mit fantastischen Schnorchelmöglichkeiten. Neben den üblichen Verdächtigen (Papageienfische, Seeigel) sehe ich sehr große Anemonenfische, einen riesigen Kofferfisch, eine Meeresschildkröte, einen Cattlefisch (ähnelt einem Tintenfisch) und eine essende Seegurke, die stark an die Biester aus „Im Land der Raketenwürmer“ erinnert. Am nächsten Morgen gehen wir den einzigen vorhandenen Wanderweg: rauf auf den nächsten Hügel. Es ist so steil, dass man sich den letzten Teil an Seilen hochziehen muss. Aber die Aussicht von oben auf die Bucht entschädigt für die Mühen. Anschließend springe ich erstmal in das helltürkise Wasser und gönne mir noch eine Dusche!
Auf dem Weg zum „Myanmar Andaman Resort“ haben meine Mitpassagierin Barb und ich unabhängig voneinander Visionen von Pizza. Ob die wohl auf der Karte steht? Mike lacht: „Das ist ein Luxushotel, das 220 Dollar die Nacht kostet. Was glaubt ihr wohl?“ Es gibt ein Menü für alle. In unserem Fall Algensalat, eine pikante Kürbissuppe und grünes Seafood-Curry. Auch gut – aber verflixt teuer. Sie haben auch Cocktails und Wein zu sehr europäischen Preisen. Die Anlage ist klein: 22 Bungalows, die 2005 so geschickt in die Landschaft eingefügt wurden, dass man sie nur ganz aus der Nähe sehen kann. Es sind kaum Gäste da, wir haben fast alles für uns. Das Resort ist nur Leuten zu empfehlen, die wirklich Ruhe suchen. Zweimal pro Woche bringt das hauseigene Speedboot mit zwei 300-PS-Motoren die Gäste von und nach Kawthoung. Das Ganze gehört einem Geschäftsmann aus Yangon, der sehr gute Regierungskontakte haben muss, und liegt in einer Bucht mit fantastischen Schnorchelmöglichkeiten. Neben den üblichen Verdächtigen (Papageienfische, Seeigel) sehe ich sehr große Anemonenfische, einen riesigen Kofferfisch, eine Meeresschildkröte, einen Cattlefisch (ähnelt einem Tintenfisch) und eine essende Seegurke, die stark an die Biester aus „Im Land der Raketenwürmer“ erinnert. Am nächsten Morgen gehen wir den einzigen vorhandenen Wanderweg: rauf auf den nächsten Hügel. Es ist so steil, dass man sich den letzten Teil an Seilen hochziehen muss. Aber die Aussicht von oben auf die Bucht entschädigt für die Mühen. Anschließend springe ich erstmal in das helltürkise Wasser und gönne mir noch eine Dusche!
















 Im
Im  Auf dem Weg Richtung Süden halten wir in dem Dorf Ambatovaky. Mit Unterstützung des Isalo-Nationalparks haben die Bauern dort die Schmiedekunst gelernt und produzieren aus Altmetall Schaufeln, die sie auf einem nahen Markt verkaufen. Dementsprechend sieht man, dass viele neue Häuser gebaut werden. Im Gegensatz zu anderen Orten gibt es keine bettelnden Kinder. Die Gegend wird immer trockener und wüstenähnlicher, mit vielen Kakteen. Ein Stück verläuft die Straße parallel zu Bahngleisen. Die Züge brauchen für die knapp 170 Kilometer lange Strecke von Fianarantsoa zur Ostküste mindestens zehn Stunden, erklärt unser Tourguide Bruno. Ist ja fast wie bei der Deutschen Bahn…
Auf dem Weg Richtung Süden halten wir in dem Dorf Ambatovaky. Mit Unterstützung des Isalo-Nationalparks haben die Bauern dort die Schmiedekunst gelernt und produzieren aus Altmetall Schaufeln, die sie auf einem nahen Markt verkaufen. Dementsprechend sieht man, dass viele neue Häuser gebaut werden. Im Gegensatz zu anderen Orten gibt es keine bettelnden Kinder. Die Gegend wird immer trockener und wüstenähnlicher, mit vielen Kakteen. Ein Stück verläuft die Straße parallel zu Bahngleisen. Die Züge brauchen für die knapp 170 Kilometer lange Strecke von Fianarantsoa zur Ostküste mindestens zehn Stunden, erklärt unser Tourguide Bruno. Ist ja fast wie bei der Deutschen Bahn… Am nächsten Tag wandern wir durch den
Am nächsten Tag wandern wir durch den 
 Meine
Meine  „Wenn Dubrovnik das Herz Dalmatiens ist, dann ist Split die Seele“, sagt die Tourbeschreibung über die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Im Zentrum von
„Wenn Dubrovnik das Herz Dalmatiens ist, dann ist Split die Seele“, sagt die Tourbeschreibung über die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Im Zentrum von  Auf dem Weg zur Nachbarinsel
Auf dem Weg zur Nachbarinsel  Am nächsten Morgen ist endlich richtig Wind! Allerdings bläst der Maestral so kräftig, dass der Skipper entscheidet, nicht zu segeln. Auf der bisher so ruhigen See herrscht plötzlich ziemlicher Wellengang, ein Teil der achtköpfigen Crew ist seekrank. Mit Motor erreichen wir
Am nächsten Morgen ist endlich richtig Wind! Allerdings bläst der Maestral so kräftig, dass der Skipper entscheidet, nicht zu segeln. Auf der bisher so ruhigen See herrscht plötzlich ziemlicher Wellengang, ein Teil der achtköpfigen Crew ist seekrank. Mit Motor erreichen wir  Der Wind ist launisch: Am folgenden Tag ist er fast völlig eingeschlafen. Also wird für die Überfahrt nach
Der Wind ist launisch: Am folgenden Tag ist er fast völlig eingeschlafen. Also wird für die Überfahrt nach  Als wir Korčula verlassen und hinter der Insel vorkommen, ist genug Wind zum Segeln. Auf der Nachbarinsel
Als wir Korčula verlassen und hinter der Insel vorkommen, ist genug Wind zum Segeln. Auf der Nachbarinsel 
 Den Rest der Strecke fahren wir mit dem Taxi. Die letzte Nacht verbringe ich einem Gästehaus in der Altstadt von
Den Rest der Strecke fahren wir mit dem Taxi. Die letzte Nacht verbringe ich einem Gästehaus in der Altstadt von 
 Hurra: Eine Woche Segeln in der Bucht von Phang Nga! Wir starten in
Hurra: Eine Woche Segeln in der Bucht von Phang Nga! Wir starten in  h liegt zwar auf dem Festland, ist aber von Felsen umschlossen und nur mit dem Boot zu erreichen. Als ich durch den kleinen Ort zum Strand Hat Phra Nang laufe, tropft es neben mir. Ist doch gar keine Regenwolke am Himmel? Über mir im Baum sitzt ein Affe und pinkelt ungeniert. Eine ganze Bande treibt sich dort herum. Die kleinen Biester lassen sich gerne von Touristen füttern und trinken sogar Wasser manierlich aus Plastikflaschen. Wenn ein Affe zur Abwechslung eine Krabbe essen will, steckt er seinen Schwanz in deren Loch. Die Krabbe kneift zu und er zieht sie heraus. Zwischendurch zweigt ein Weg zu einer Lagune ab, der jedoch ziemlich selbstmörderisch aussieht. Es geht fast senkrecht hoch. Die ganze Gegend ist ein Paradies für Kletterer. Außerdem sind die Felsen von Höhlen durchzogen. Echt schräg: Einzelne vom Boden emporwachsende Tropfsteine sind mit bunten Bändern geschmückt und in den beiden Höhlen am Strand stehen zusätzlich kleine Altäre sowie Holzpenisse in allen erdenklichen Größen. Jetzt weiß ich auch, warum Phillip die Höhlen als „phallisch“ beschrieben hat… Abends setzen wir mit dem Dinghi zur benachbarten Bucht Ao Ton Sai über, die von urgemütlichen Strandbars mit Hippie-Flair gesäumt ist. Auf der Karte wird u.a. ein „Magic Mushroom Shake“ angeboten. Erstmals höre ich Reggae auf Thai. Wir landen bei Ebbe und müssen durch zähen, knöcheltiefen Schlick stapfen. Danach sehen wir aus, als würden wir Socken tragen.
h liegt zwar auf dem Festland, ist aber von Felsen umschlossen und nur mit dem Boot zu erreichen. Als ich durch den kleinen Ort zum Strand Hat Phra Nang laufe, tropft es neben mir. Ist doch gar keine Regenwolke am Himmel? Über mir im Baum sitzt ein Affe und pinkelt ungeniert. Eine ganze Bande treibt sich dort herum. Die kleinen Biester lassen sich gerne von Touristen füttern und trinken sogar Wasser manierlich aus Plastikflaschen. Wenn ein Affe zur Abwechslung eine Krabbe essen will, steckt er seinen Schwanz in deren Loch. Die Krabbe kneift zu und er zieht sie heraus. Zwischendurch zweigt ein Weg zu einer Lagune ab, der jedoch ziemlich selbstmörderisch aussieht. Es geht fast senkrecht hoch. Die ganze Gegend ist ein Paradies für Kletterer. Außerdem sind die Felsen von Höhlen durchzogen. Echt schräg: Einzelne vom Boden emporwachsende Tropfsteine sind mit bunten Bändern geschmückt und in den beiden Höhlen am Strand stehen zusätzlich kleine Altäre sowie Holzpenisse in allen erdenklichen Größen. Jetzt weiß ich auch, warum Phillip die Höhlen als „phallisch“ beschrieben hat… Abends setzen wir mit dem Dinghi zur benachbarten Bucht Ao Ton Sai über, die von urgemütlichen Strandbars mit Hippie-Flair gesäumt ist. Auf der Karte wird u.a. ein „Magic Mushroom Shake“ angeboten. Erstmals höre ich Reggae auf Thai. Wir landen bei Ebbe und müssen durch zähen, knöcheltiefen Schlick stapfen. Danach sehen wir aus, als würden wir Socken tragen. Weiter südlich in der Bucht wird der Sand weißer, das Wasser klarer und türkiser. Hier kommen die besten Schorchelplätze der Region, z.B.
Weiter südlich in der Bucht wird der Sand weißer, das Wasser klarer und türkiser. Hier kommen die besten Schorchelplätze der Region, z.B.  Von Kata Beach aus fahre ich gut zweieinhalb Stunden lang mit einem Minibus nach Nordosten. Langsam ändert sich die Landschaft. Die durchgehende Bebauung weicht erst Plantagen, dann wird der Wald langsam dichter, die Landschaft hügeliger. Ziel ist das
Von Kata Beach aus fahre ich gut zweieinhalb Stunden lang mit einem Minibus nach Nordosten. Langsam ändert sich die Landschaft. Die durchgehende Bebauung weicht erst Plantagen, dann wird der Wald langsam dichter, die Landschaft hügeliger. Ziel ist das  Vom Khao Sok Nationalpark ist es nur ein Katzensprung zum Küstenort
Vom Khao Sok Nationalpark ist es nur ein Katzensprung zum Küstenort  Von dort gehts weiter zu den neun Similaninseln, die der Einfachheit halber durchnummeriert sind. Zunächst schnorcheln wir vor Nr. 9. Es wird einfach nie langweilig: Eine schwarzweiß geringelte Seeschlange zieht unter mir durch, ebenso wie riesige Papageienfische, auf denen kleine Anhalter mitschwimmen. Nr.
Von dort gehts weiter zu den neun Similaninseln, die der Einfachheit halber durchnummeriert sind. Zunächst schnorcheln wir vor Nr. 9. Es wird einfach nie langweilig: Eine schwarzweiß geringelte Seeschlange zieht unter mir durch, ebenso wie riesige Papageienfische, auf denen kleine Anhalter mitschwimmen. Nr.